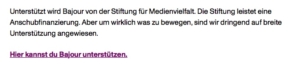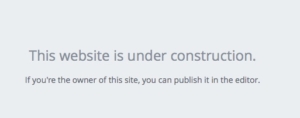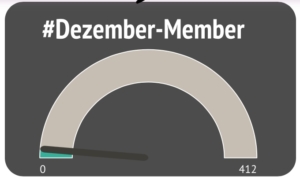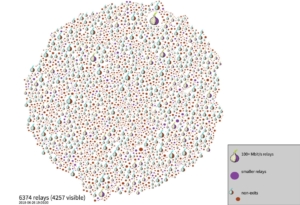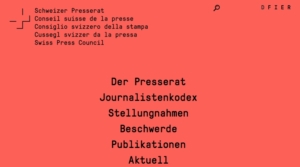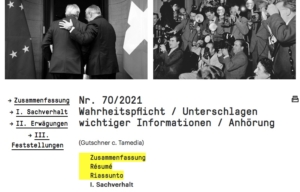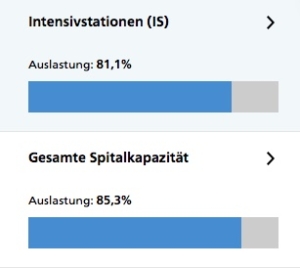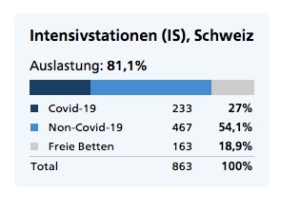Einmal Wappler, bitte
Die NZZaS versuchte, einen Wackelpudding an die Wand zu nageln.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Ein Interview mit Nathalie Wappler ist etwa so erkenntnisfördernd wie der Versuch, die «Tagesschau» zu interviewen.

Wappler versucht es immer wieder mit der gleichen Strategie. Leugnen, zurückfragen, dann wieder leugnen.
Die NZZaS konstatiert, dass die Sparnmassnahmen zu einer Qualitätseinbusse geführt haben, beispielsweise beim Flaggschiff von SRF, den Nachrichtensendungen. Verteidigungslinie eins von Wappler:
«Dass die Qualität der Sendungen ungebrochen hoch ist, wird uns regelmässig von unabhängiger Stelle attestiert.»
Wechsel von Defensivverteidigung zur Offensive: «Weshalb ist es aus Ihrer Sicht eine Qualitätsminderung, wenn ein Beitrag länger und vertiefter ist?»
Die NZZaS legt nach, dass sei nicht ihre Meinung, sondern Mitarbeiter hätten ausgesagt, dass sie ausdrücklich als Sparmassnahmen angehalten worden seien, Beiträge in Live-Schaltungen durch «längere Gespräche und Zusatzfragen in die Länge zu ziehen».
Nun geht Wappler etwas die Luft aus, also wird sie apodiktisch: «Das sind keine Sparmassnahmen.» Sondern das diene der «Vertiefung».
Wapplers ewig gleiche Taktik
Gleiche Taktik bei Fragen nach dem Abbau in der Kultur. Zuerst Gegenoffensive, dann halbes Eingeständnis: «Das mit dem Sparen ist ernst. Glauben Sie mir, ich hätte lieber neue Formate entwickelt und gleichzeitig die alten behalten. Das ging aber nicht.»
Die NZZaS hakt nach, dass Kultursendungen gestrichen wurden, ohne einen Ersatz zu präsentieren. Da versucht sich Wappler in absurder Logik: «Was soll ich entwickeln, bevor ich weiss, wie viele Mittel ich für die Weiterentwicklung habe?»
Das könnte man in einer ordentlichen Finanzflussplanung theoretisch hinkriegen, aber wieso auch. Dann setzt sie noch einen drauf: «Zu unserer Unabhängigkeit gehört auch, dass wir die Finanzen in Ordnung halten.»
Das muss man nun zumindest als nassforsch bezeichnen, bezüglich Finanzgebaren, Verzögerungen, Zusatzkosten beim Newsroom usw. spricht sogar der sonst um christliche Sanftmut bemühte Parteipräsident der «Mitte» Gerhard Pfister von einem «Saftladen». Aber das kratzt natürlich eine Wappler nicht.
Auch auf die Frage, wieso SRF nicht von den drei TV- und sechs Radiosendern ein paar streiche, die Konzession fordert nur insgesamt fünf, versucht es Wappler mit einer Gegenfrage: «Wieso soll ich in einer Welt mit immer mehr Medienkanälen ausgerechnet Kanäle streichen?»
Knappe Replik der NZZaS: «Weil Sie sparen müssen, um Geld für neue digitale Projekte zu haben.» Da macht Wappler den Wackelpudding: «Die heutigen Sender laufen ja gut.»

Abgesehen davon, dass das sehr relativ ist; wo ist hier der Bezug zur Frage? Im weiteren Verlauf des Interviews verwendet Wappler diesen Trick wieder und wieder.
Antworten auf Fragen, die nicht gestellt wurden
Kritische Fragen an einen Bundesrat? «Sagen Sie mir, wo nicht.» Interne Unruhen und viele namhafte Abgänge? «Erklären Sie mir das mit den vielen Abgängen, bitte.» Die NZZaS erklärt mit langer Namensliste. Darauf Wappler: «Ich finde es immer schade, wenn Kolleginnen und Kollegen das Haus verlassen.»
Das mag ja so sein, nur war das nicht die Frage. «Wir sind immer noch ein attraktiver Arbeitgeber», die NZZaS kontert mit einer Mitarbeiterbefragung, in der desaströse 54 Prozent SRF als attraktiven Arbeitgeber bezeichnen. Kühle Antwort:
«Eine derart grosse Transformation ist mit Irritation verbunden.»
Natürlich ist es einer Chefin unbenommen, ihre Politik, ihre Entscheidungen und deren Auswirkungen zu verteidigen. Aber dermassen realitätsfern, abgehoben, arrogant und uneinsichtig, das ist bedenklich. Das riecht nach überspielter Unsicherheit. Nach leichtem Angstschweiss. Nach Hilflosigkeit, Prozesse zu lenken und zu verstehen, Keine schöne Sache für die Mitarbeiter bei SRF.