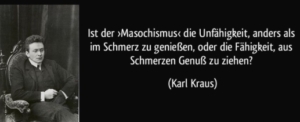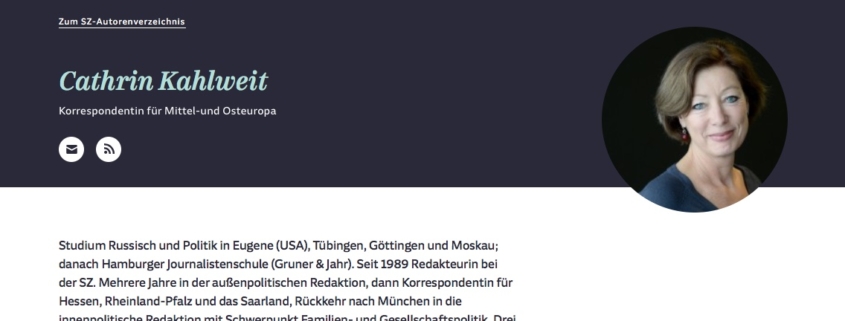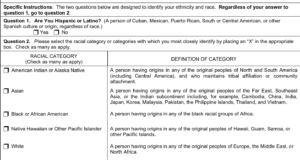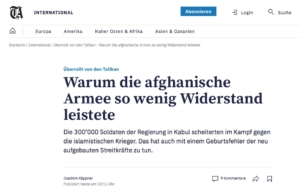Logik kaputt
Der SZ-Redaktor Joachim Käppner vergewaltigt öffentlich die Logik und missbraucht Stalingrad.
Man übernimmt nicht ungestraft jeden Unsinn aus München – und quält erst noch den zahlenden Leser des Qualitätskonzerns Tamedia. Denn dort zieht einer vom Leder:
«Die Ignoranz von Amnesty International gegenüber den Opfern eines Zerstörungskrieges ist bestürzend.»
Bestürzend ist vielmehr die Ignoranz des Autors gegen Grundregeln der Logik.

Das ist allerdings kein Unfall, sondern ein bewusst herbeigeführter journalistischer Schadensfall. Der Autor behauptet: «Amnesty hat nämlich der russischen Kriegspropaganda ein unverhofftes Geschenk gemacht.» Damit zeige die NGO eine «atemberaubende Ignoranz gegenüber den Opfern eines Zerstörungskrieges». Früher nannte man das bei ihm zu Hause Defätismus und Übernahme von Feindpropaganda.
Dann wird Käppner noch teutonisch-geschmacklos: «In der seltsamen Logik des Ukraine-Berichts müsste man auch der Roten Armee, als sie 1942 Stalingrad gegen die Wehrmacht verteidigte, völkerrechtswidriges Verhalten vorwerfen. Obwohl noch Zivilisten in der Trümmerstadt waren, kämpften die sowjetischen Soldaten um jedes Haus. Was hätten sie sonst tun sollen?»
Worin besteht seine verkehrte Logik? Amnesty International hat einen Bericht über ukrainische Kriegsverbrechen veröffentlicht. Jeder, der ihn liest, hat keinen Zweifel daran, dass die aufgeführten Beispiele sorgfältig untersucht und belegt sind. Seine Zusammenfassung:
-
Wohngebiete, Schulen und Krankenhäuser dienen als Militärstützpunkte
-
Angriffe aus dicht besiedelten zivilen Gegenden provozieren Vergeltungsschläge
-
Diese Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht rechtfertigen allerdings nicht die wahllosen Angriffe Russlands mit zahllosen zivilen Opfern
AI untermauert diese Vorwürfe, was ausführlich zitiert werden muss:
«Zwischen April und Juli verbrachten Expert*innen von Amnesty International einige Wochen damit, russische Angriffe in den Regionen Charkiw und Mykolajiw und im Donbass zu untersuchen. Sie untersuchten Orte, an denen Angriffe stattgefunden hatten, sprachen mit Überlebenden, Zeug*innen und Angehörigen der Opfer, und führten Fernerkundungen und Waffenanalysen durch.
Bei diesen Untersuchungen fanden die Amnesty-Mitarbeiter*innen in 19 Städten und Dörfern dieser Regionen Belege dafür, dass ukrainische Truppen aus dicht besiedelten Wohngebieten heraus Angriffe durchführten und Stützpunkte in zivilen Gebäuden einrichteten. Das «Crisis Evidence Lab» von Amnesty International hat einige dieser Geschehnisse zusätzlich durch die Auswertung von Satellitenaufnahmen bestätigt.
Die meisten der als Stützpunkte genutzten Wohngebiete befanden sich mehrere Kilometer hinter der Front. Es wären tragfähige Alternativen verfügbar gewesen, die keine Gefahr für die Zivilbevölkerung bedeutet hätten – wie zum Beispiel nahegelegene Militärstützpunkte oder Waldstücke oder andere weiter entfernte Gebäude. In den von Amnesty International dokumentierten Fällen liegen keine Hinweise darauf vor, dass das ukrainische Militär die Zivilpersonen in den Wohngegenden aufgefordert oder dabei unterstützt hätte, Gebäude in der Nähe der Stützpunkte zu räumen. Dies bedeutet, dass nicht alle möglichen Vorkehrungen zum Schutz der Zivilbevölkerung getroffen wurden.»
Gleichzeitig stellt AI klar, wer der Aggressor und Verursacher des Krieges ist: «Bei der Abwehr des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs hat das ukrainische Militär wiederholt aus Wohngebieten heraus operiert und damit Zivilpersonen in Gefahr gebracht. … Gleichzeitig rechtfertigen die ukrainischen Verstöße in keiner Weise die vielen wahllosen Schläge des russischen Militärs mit zivilen Opfern, die wir in den vergangenen Monaten dokumentiert haben. Wahllose Angriffe, bei denen Zivilpersonen verletzt oder getötet werden, sind Kriegsverbrechen.»
Selbstverständlich hatte AI zuvor auch russische Kriegsverbrechen dokumentiert und kritisiert. Im Gegensatz zur Absurd-Logik des deutschen Demagogen Käppner gibt es keine guten oder schlechten, keine gerechtfertigten oder ungerechtfertigten Kriegsverbrechen. Es gibt keine für die gute Sache, über die man daher schweigen muss, während man Kriegsverbrechen für die schlechte Sache anzuprangern hat.
Um in seiner Unsinns-Logik zu bleiben: die Massenvergewaltigungen durch Soldaten der Roten Armee während des Einmarschs ins Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg waren Kriegsverbrechen. Sie sind nicht entschuldbar, aber zumindest verständlich, wenn man bedenkt, welche unsäglichen Nazi-Verbrechen diese Soldaten sehen mussten, als sie von den Faschisten okkupierte Teile der Sowjetunion befreiten.
In Stalingrad verteidigte die Rote Armee tatsächlich Haus um Haus, sie wählte aber nicht absichtlich Schulen oder Krankenhäuser als Militärstützpunkte. Wer dieses Beispiel anführt, müsste zwangsweise von Wassili Grossmann «Leben und Schicksal» sowie «Stalingrad» lesen müssen. Denn der war da und hat’s aufgeschrieben. In einer Weise, die dem Leser das Herz beklemmt. Auf dass Käppner niemals mehr so geschmacklos über diese unsägliche Tragödie schreibe und überhaupt die Schnauze halte.