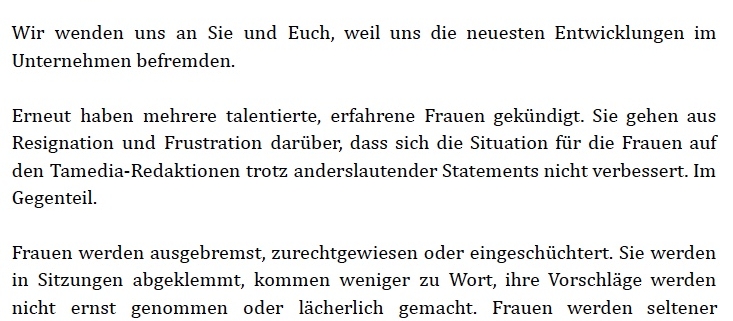Die toleranten Frauenversteher im Haus der politischen Korrektheit haben nun das Geschenk. Ein Protestschreiben von 78 Mitarbeiterinnen mit absurden Forderungen und Weinerlichkeiten.
Erst als ein paar der unterzeichnenden Frauen und Oberchefredaktor Arthur Rutishauser gegenüber ZACKBUM bestätigten, dass dieses Schreiben authentisch ist, konnten wir es glauben.
Denn wir hatten im Hinterkopf, dass ein begabter Imitator diesen vierseitigen «Protestbrief» nebst «Forderungen» verfasst haben könnte. Denn den Inhalt trauten wir nicht mal den 78 Unterzeichnerinnen zu.
Der uns vorliegende Brief hebt damit an, dass «erneut mehrere talentierte, erfahrene Frauen gekündigt» hätten. Aus «Resignation und Frust darüber», dass sich die Situation der Frauen in den Tamedia-Redaktionen nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert hätte. «Trotz anderslautender Statements.»
Dagegen teilte die Geschäftsleitung ebenfalls Freitagnachmittag den Zwischenstand bei der Arbeitsgruppe «Diversity» unter Leitung von Priska Amstutz, Unter-Co-Chefredaktorin beim «Tages-Anzeiger», mit. Hier wird unter anderem festgehalten, dass in der Geschäftsleitung von Tamedia das Verhältnis Männlein Weiblein «relativ ausgeglichen» sei. Noch besser: «Die Lohngleichheit wird regelmässig mittels Lohnanalysen überprüft. Diese zeigen, dass es keine Hinweise auf systematische Unterschiede gibt.»
Das Schreiben in seiner vollen Pracht: Schreiben_GL
Zustände bei Tamedia wie in Saudi-Arabien?
Aber laut dem Protestschreiben müssen in Wirklichkeit Zustände auf den Tamedia-Redaktionen herrschen, an denen Fundamentalisten, Burka-Befürworter und religiöse Irre ihre helle Freude hätten. Denn fast wie in Saudi-Arabien würden Frauen «ausgebremst, zurechtgewiesen oder eingeschüchtert». Schlimmer noch: «Sie werden in Sitzungen abgeklemmt, kommen weniger zu Wort, ihre Vorschläge werden nicht ernst genommen oder lächerlich gemacht.»
Kein Wunder, dass die Tamedia-Frauen so daran gehindert werden, ihre Arbeit «motiviert, hartnäckig, leidenschaftlich» zu machen. Also arbeiten sie offenbar demotiviert, kurzatmig und leidenschaftslos. Der Umgangston sei «harsch», oft auch beleidigend. Da soll doch «ein Mitglied der Chefredaktion» einer Redaktorin gesagt haben, «sie sei überhaupt nicht belastbar».
Da sämtliche Täter, Opfer, Gegangene oder noch Leidende nur anonym im schlechtesten «Republik»-Stil vorkommen, lässt es sich leider nicht eruieren, ob die Redaktorin nach dieser sexistischen, ungeheuerlichen Beleidigung notfallmässig ins Spital eingeliefert werden musste, sich seither in einer Burn-out-Klinik gesund pflegen lässt oder unter schweren Medikamenten arbeitsunfähig geschrieben wurde.
Das Problem bei Tamedia ist – «strukturell»
Auf jeden Fall, das Wort kennen wir aus allen Formen der Diskriminierung, die Probleme seien «strukturell». Aber, so wie «Black lives matter» vor allem in der Schweiz das unerträgliche Schicksal der Schwarzen deutlich verbessert hat, auch hier gibt man, Pardon, frau, sich kämpferisch: «Wir sind nicht bereit, diesen Zustand länger hinzunehmen.»
Nehmt das, ihr Macho-Männer an den Schalthebeln, hier kommen die Frauen und fordern. Selbstverständliches («wir erwarten, mit Anstand und Respekt behandelt zu werden»), natürlich eine «anonymisierte Umfrage», wo frau ungehemmt losschimpfen kann. Ein Kessel Buntes zusammen mit Absurditäten. Es soll und muss mehr Frauen in «Führungspositionen» geben, «neue strategisch wichtige Teams» sollen «von Anfang an mit mindestens einem Drittel Frauen besetzt werden». Dann natürlich das Übliche, Frauenförderung und eine Diversity-Beauftragte (oder ein -beauftragter, immerhin).
Aber was sind schon Forderungen ohne Ultimatum: «Wir erwarten bis zum 1. Mai 2021 konkrete Vorschläge zur Umsetzung unserer Forderungen.» Unterschrieben ist das Ganze von Salome Müller, der Meisterin des non-binären Gendersternchens, bis Andrea Fischer, altgediente, aber unauffällige Tamedia-Redaktorin seit über 21 Jahren. Allerdings: Was ist schon ein Ultimatum ohne Drohung? Wenn nicht, dann verstopfen wir mit Tampons das Männerklo? Da müsste doch etwas kommen.
Die Auflistung des täglichen sexistischen Grauens
In einem «Anhang» wird dann auf siebeneinhalb Seiten das unerträgliche Höllenfeuer mit Beispielen lodern gelassen, dem sich Tamedia-Redaktorinnen ausgesetzt sehen. Erniedrigungen, anzügliche Bemerkungen, sexistische Schweinereien, gar Schlimmeres erwartet hier der erschütterte oder voyeuristische Leser, je nachdem.
Beide werden bitter enttäuscht. Es ist eine peinliche, entlarvende, erbärmliche Auflistung von mehr oder minder dümmlichen Sprüchen, die in jedem grösseren Unternehmen gesammelt werden könnten. Jede wirklich unter männlicher Unterdrückung und primitiver Anmache leidende Frau würde sich darüber totlachen. Ein paar Müsterchen? «Du bist hübsch, du bringst es sicher noch zu was.»
«Als jemand das Thema Gendersternchen vorschlug, hiess es erst, es sei schon genug «Klamauk» zum Thema gemacht worden. Das richtete sich nicht per se gegen eine Frau, aber gegen die Art des gendergerechten, integrierenden Schreibens.»
«Bei einem Text, der ausschliesslich von der Perspektive junger Frauen handelte, sagte der ältere Vorgesetzte: «Es ist falsch, was du schreibst.»
«An Sitzungen wiederholen Männer oft die Ideen, die in den ersten 5 Minuten von Frauen des Meetings vorgebracht wurden. Die Männer ergänzen die Idee nicht, sondern sagen einfach dasselbe, ohne zu erwähnen, dass die Idee von Kollegin xy stammt.»
«Aber ihr seid doch mitgemeint, wenn man das generische Maskulinum benutzt.» – «Nein, ich fühle mich nicht mitgemeint. Du weisst nicht, wie ich mich fühle.» – «Ihr seid mitgemeint. Das ist historisch so.»
«Es wird uns Journalistinnen nicht zugetraut, entsprechend unseres journalistischen Instinkts und unserer Expertise Themen zu erkennen und journalistisch umzusetzen.»
«In einer Blattkritik wurde der Einstieg eines Textes über den historischen Frauenstreik kritisiert: «Wir sollten ob unserer Begeisterung nicht unser Urteilsvermögen aufgeben.»»
«Ich: «Verdienen Männer hier denn mehr als Frauen, wie ist es so mit der Lohngleichheit?» Antwort, schreiend: «Du musst den Vertrag ja nicht unterschreiben.»»
Habe ich das erfunden? Nein, unmöglich. Ist das ernstgemeint? Nun ja, das ist zu befürchten. Warum ist das so? Das kommt davon, wenn sich die beiden verzwergten Co-Unter-Chefredaktoren in feministischer Kampfschreibe überbieten wollen. Das kommt davon, wenn die Führung des Ladens jedes Mal zusammenzuckt, wenn eine weder des Schreibens noch der deutschen Rechtschreibung mächtige Redaktorin Schwachsinn wie die allgemeine Einführung des Gender-Sternchens, den Kampf gegen die Unterdrückung der Frau innerhalb und ausserhalb der Redaktion einfordert.
Wer noch nicht genug hat: Brief an CR_GL von 78 Tamedia-Frauen 05.03.2021
Wenn fehlgeleitete Verbal-Radikal-Feministinnen das Unterdrückungssymbol Verschleierung zum Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung in der Kleiderwahl umlügen, dabei sogar noch von führenden, männlichen Opportunisten unterstützt werden, wenn jede verbale Attacke zum sexistischen Übergriff umgedeutet wird, dann kommt es zu solchen Metastasen der abgehobenen Idiotie.
Dieses Bedürfnis nach usurpiertem Phantomleiden
Es ist diese Haltung des geliehenen Opferstatus, des Leidens an Phantomschmerzen, dieser Stellvertreterkrieg mangels echten Schlachten und Opfern, die Umdeutung von Nichtigkeiten zu Gewalttätigkeiten, die unglaublich nervt. Weil Redaktorinnen in der geschützten Werkstatt Tamedia auch gerne mal so richtig als fürchterlich unterdrückte, ausgegrenzte, misshandelte, sexistisch angegangene, ständig von Männergewalt, Vergewaltigungsversuchen und brutalster Unterdrückung leidende Frauen gesehen werden möchten.
Aber weil niemand sie so sieht, weil es nicht so ist, weil bei Tamedia jeder Vorgesetzte weiss, dass er ein Riesenproblem hat, wenn eine Mitarbeiterin die Kritik an ihrem völlig gescheiterten Text flugs als Ausdruck männlicher Unterdrückung von fraulichen Perspektiven umdeutet, wird dem Wahnsinn Tür und Tor geöffnet.
Wo zu viel Verständnis vorhanden ist – oder geheuchelt wird –, wächst das Unverständliche in den Himmel.
Wunderlich ist nur: Von allen Chefchefs abwärts bis zu Pygmäen-Chefs wie Mario Stäuble und anderen wird wortreich, erschütternd die vielfältige Unterdrückung, der Missbrauch der Frau, gerade in der Schweiz, angeprangert. Aber wenn es so schlimm ist, wie diese 78 Redaktorinnen behaupten, wenn es bei Tamedia täglich schlimmer wird, wieso haben denn all diese Frauenversteher, diese Kämpfer für Gleichberechtigung, diese unerschrockenen Kommentarschreiber gegen jede Form von männlichem Sexismus, das denn nicht in ihrem nächsten Umfeld bemerkt?
Wieso merkt das denn keiner der männlichen Kampffeministen bei Tamedia?
Da kann es nur drei Erklärungen geben. Die unterzeichnenden Redaktorinnen haben in ihrer Gesinnungsblase völlig den Bezug zur Realität verloren. Oder aber, sie wollen nun vereint jede Kritik an ihrem professionellen Ungenügen von vornherein verunmöglichen. Oder, alle männlichen Wortführer für die Sache der Frau sind in Wirklichkeit abgrundtiefe Heuchler.
Die Wahrheit dürfte aus all diesen drei Teilen bestehen. Selber schuld, aber wer möchte denn jetzt gerade ein männlicher Vorgesetzter sein, der einer weiblichen Untergebenen näherbringen muss, dass ihr Text schlichtweg Schrott, unbrauchbar, nicht zu retten, schwachsinnig, fehlerhaft, unlogisch, nicht durch Fakten abgestützt ist? Zudem Ausdruck einer mehr als schlampigen Recherche? Das arme Schwein sitzt fünf Minuten später – von einer Fristlosen bedroht – bei Human Resources und muss sich gegen den Vorwurf verteidigen, er habe die Redaktorin als Schlampe tituliert.
Wobei sie das atomare Argument über ihm explodieren lassen darf: «Wie auch immer, ich habe das aber so empfunden.» Und wer, ausser wir bei ZACKBUM, würde sich trauen, dieses 12-seitige Schreiben als Bankrotterklärung aller Anliegen, für die sich die Frauenbewegung zu Recht in den letzten hundert Jahren eingesetzt hat, zu bezeichnen?
Wer den Wahnsinn wuchern lässt, wird von ihm verschlungen
Denn es war, ist und bleibt klar: Es gibt gute Texte, mittelmässige Texte und Schrott. Dafür gibt es keine objektiven Kriterien, aber doch vorhandene. Keines dieser Kriterien hat mit dem echten oder eingebildeten Geschlecht des Autors zu tun. Lässt Tamedia diesen selbst gezüchteten Unsinn wirklich ausarten, dann wird das Haus bald einmal auch Fragen wie in Holland diskutieren müssen. Wer denn überhaupt legitimiert ist, über welche Themen wie zu schreiben. So wie dort ernsthaft debattiert wird, wer das pubertäre Gedicht von Amanda Gorman übersetzen darf. Wohl nicht eine weisse Frau mit ganz anderem kulturellem Hintergrund als die hinaufgejubelte schwarze Gebrauchslyrikerin aus den USA.
Die Tamedianerinnen wärmen einfach einen der urältesten demagogischen Kniffe auf diesem Gebiet auf. «Diese Arbeit ist unterirdisch schlecht.» – «Das sagst du nur, weil ich eine Frau bin.» – «Nein, das sage ich, weil die Arbeit ein Pfusch ist.» – «Du als Mann kannst das doch gar nicht beurteilen.» – «Doch, auch als weisser, heterosexueller, privilegierter alter Mann kann ich beurteilen, wie die Arbeit einer schwarzen, lesbischen, unterprivilegierten jungen Frau ausgefallen ist.»
Alle Apologeten eines Glaubens, einer Ideologie, einer Diktatur behaupten, dass es bestimmte Voraussetzungen braucht, um etwas beurteilen zu können. Sei das das Tragen eines Kopfschmucks, das richtige Verstehen eines heiligen Buchs, die dialektisch-materialistische Analyse der objektiven Klassenverhältnisse, die einem nur nach tiefen Studium der Werke von Marx/Engels zusteht – oder das Vorhandensein oder die Abwesenheit bestimmter Geschlechtsorgane oder Hautpigmente. All das ist immer wieder der gleiche Schwachsinn, der immer wieder besiegt werden muss.
Denn merke: Wenn man dem Wahnsinn nicht rechtzeitig und energisch Einhalt gebietet, dann will er die Herrschaft ergreifen. Oder die Frauschaft.