Was ist nur im «Magazin» von Tamedia los?
Starker Tobak: «Als Finn Canonica 2007 »Magazin«-Chefredakteur wurde, begann er ein Regime des Mobbings. Ich war nicht die Einzige, er nahm auch Männer ins Visier. Eine Kollegin entließ er ohne Vorwarnung. Als ihr das Mutterblatt des »Magazins«, der »Tages-Anzeiger«, direkt danach eine Reporterstelle anbot, soll Canonica gesagt haben, man untergrabe seine Autorität, würde man sie dort anstellen. Sie trat die Stelle nicht an.»
Das schreibt die langjährige «Magazin»-Journalistin Anushka Roshani im «Spiegel». Sie war von 2002 bis 2022 dort angestellt, bis sie laut eigenen Angaben «im September 2022 ohne Angaben von Gründen die Kündigung erhielt». Gleichzeitig klagt sie «wegen Verletzung der Fürsorgepflicht aufgrund sexistischer Diskriminierung und Mobbings» gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber.
Sie gehörte zu den erregten Frauen, die einen Protestbrief gegen angeblich unerträgliche, sexistische und demotivierende Zustände bei Tamedia unterzeichnet hatten. Ohne dass allerdings ihre oder andere Beispiele namentlich genannt wurden.
Also ist Roshani nicht gerade eine objektive Zeugin oder unbeleckt von Eigeninteresse. Und die Fähigkeiten des «Spiegel», die Plausibilität von Erzählungen zu überprüfen, ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Laut persoenlich.com weise der Anwalt des ehemaligen «Magazin»-Chefredaktors die Anschuldigungen zurück. Und Tamedia lässt ausrichten, eine «externe Untersuchung habe Roshanis Vorwürfe «zum überwiegenden Teil» nicht bestätigt». Welcher Teil bestätigt wurde, bleibt offen.
Der «Spiegel» hat sich nach eigenen Angaben nicht alleine auf die Schilderungen von Roshani verlassen: «Der Redaktion liegen Aussagen ehemaliger Kollegen und Kolleginnen, Chatnachrichten, Korrespondenz und Dokumente vor, die die Vorwürfe stützen und insgesamt plausibel erscheinen lassen. Soweit einzelne Vorwürfe, etwa über den Inhalt von Vieraugengesprächen, allein auf Wahrnehmungen von Anuschka Roshani beruhen, hat sie diese eidesstattlich versichert.»
Auch hier gilt natürlich wie immer die Unschuldsvermutung.
Aber: Es pfiffen schon länger die Spatzen von den Dächern, dass der abrupte Abgang von Canonica nicht dadurch motiviert war, dass der «eine neue berufliche Herausforderung» annehmen wolle.
Roshani beschreibt eine Unkultur und ein geradezu toxisches Verhalten des Chefs: «Wer zum inneren Kreis gehörte, was sich allerdings jederzeit ändern konnte, genoss Privilegien, bekam Zeit und Platz für Artikel, wurde von Aufgaben freigehalten, musste aber auch, egal ob sie oder er es wollte, Details aus Canonicas Sexleben erfahren. Er mutmaßte über die sexuelle Orientierung oder Neigungen von Mitarbeitern. Äußerte sich verächtlich über jeden, der nicht im Raum war. Bezeichnete unliebsame Themen als »schwul«. Benutzte in Sitzungen fast touretteartig das Wort »ficken«. Erzählte Intimitäten, etwa, dass zwei Redakteure ihre Kinder nur durch künstliche Befruchtung bekommen hätten.»
Ihre persönlichen Erfahrungen schildert Roshani so:
«Im Wesentlichen aber entwürdigte er mich mittels verbaler Herabsetzungen. So unterstellte er mir in einer Konferenz, ich hätte mir journalistische Leistungen mit Sex erschlichen: Ich sei mit dem Pfarrer der Zürcher Fraumünster-Kirche im Bett gewesen, den ich für eine Recherche getroffen hatte. In einer SMS sprach mich Canonica als »Pfarrermätresse« an.
Das war nicht alles. Hinter meinem Rücken nannte er mich vor einer Kollegin »die Ungefickte«. Sagte coram publico zu mir, mein Mann habe »einen kleinen Schwanz«. Brüstete sich in meinem Beisein vor Kollegen mit einem scheinbaren Exklusivwissen über mein Liebesleben: dass ich zu Beginn meiner »Magazin«-Zeit öfter die Männer gewechselt hätte.»
In dem Artikel dokumentiert Roshani einige ihrer Vorwürfe, so den, dass ihr Canonica bei angeblich zu deutschen Ausdrücken in ihren Manuskripten ein Hakenkreuz daneben gemalt hätte, sie als «Pfarrermätresse» bezeichnet oder ihr mit folgenden Worten zu einer Leistung gratuliert habe: «Obwohl Du eine Frau bist, hast du brilliert.»
Nun könnte man bis hierher sagen, dass hier ein unfähiger und unbeherrschter Diktator Chef gespielt habe, worunter seine Untergebenen zu leiden hatten. Zum systematischen Skandal wird aber diese Beschreibung dadurch, dass Roshani die gesamte Führungsriege von Tamedia beschuldigt, Canonica lange Jahre geschützt und gestützt zu haben:
«Wann immer ich mich zur Wehr setzte, gab er mir zu verstehen, dass ich niemanden im Verlag fände, der mir Gehör schenken würde. Er sitze bombenfest im Sattel und genieße sogar das große Wohlwollen des Verlegers Pietro Supino.»
Mitredakteure hätten gekündigt und teilweise Canonica als Grund bei der Personalabteilung angegeben – keine Reaktion. Nach dem Protestbrief hätten gegen aussen der damalige Geschäftsführer Marco Boselli und auch Oberchefredaktor Arthur Rutishauser Betroffenheit und Null-Toleranz behauptet, aber auf ihre wohldokumentierten Beschwerden sei man nicht eingegangen. Dabei hätte es genügend deutliche Skandale gegeben:
«Nicht mal Canonicas Affäre mit einer Untergebenen und den damit verbundenen Machtmissbrauch fand das Unternehmen als Vorwurf erheblich genug: Erst bevorzugte Canonica seine Geliebte, ohne daraus einen Hehl zu machen, ging mit ihr auf Dienstreisen, dann, nach dem Ende des Verhältnisses, verbot er uns, mit ihr zu kommunizieren.»
Die Unternehmensleitung, immer laut Roshani, habe alles getan, um das Problem auszusitzen:
«Man ließ mich vollkommen allein in dieser Lage. Ich musste an einem Tisch mit Canonica sitzen, nachdem er schon über meine Vorwürfe informiert war. Vom Stand der Untersuchung erfuhr ich nichts. Längst wissen auch der Verwaltungsrat und der Verleger Pietro Supino von den Vorfällen.
Rutishauser, Canonicas Vorgesetzter, laut ihm sein enger Studienfreund, tat, als wäre ich das Problem. Mein Arbeitgeber behandelt mich, als wäre ich eine Störung des Betriebsfriedens. Und als wäre es ein privater Zwist zwischen mir und Canonica.»
Dass hier ein saftiger Skandal geplatzt ist, scheint auch folgende Aussage von Roshani zu belegen: «So wie sich Canonica anstrengte, mich kleinzukriegen, versucht Tamedia, mich in die Knie zu zwingen. Deren Anwältin behauptet, dass ich alles nur inszeniert hätte, um Canonicas Chefposten zu bekommen.»
Ihre bittere Bilanz:
«Ende Juni gab der Verlag bekannt, Canonica verlasse »Das Magazin«, um eine »neue berufliche Herausforderung anzutreten«. Seitdem hat weder die Leserschaft noch die Redaktion erfahren, wo er abgeblieben ist. Mir sagte man, ich solle mich unterstehen, Gerüchte in die Welt zu setzen, mit meinen Vorwürfen habe sein Weggang nichts zu tun. Aus der Redaktion hieß es, er habe eine hohe Abfindung erhalten.
Canonicas Posten hat sein Vize übernommen, er ist schlicht nachgerückt. Dabei hatte der Verlag nach dem »Frauenbrief« verkündet, dass ab sofort jede Stelle intern und extern zur Bewerbung ausgeschrieben werde. Das ist hier nicht geschehen. Im Editorial verabschiedete der neue »Magazin«-Chefredakteur den alten mit Glanz und Gloria.»
Sicherlich, es handelt sich hier um die Anklageschrift einer einzelnen Journalistin, die zudem offensichtlich mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber ein Hühnchen zu rupfen hat. Es erscheint aber sehr unwahrscheinlich, dass sie sich all diese Geschichten aus den Fingern saugt. Denn im Gegensatz zu den bis heute unbewiesenen Behauptungen im Protestschreiben nennt sie konkrete Beispiele, will Zeugen haben und kann auch Belege vorweisen.

Textnachrichten von Canonica (Screenshot «Spiegel»).
Auf ganz üble Verhältnisse deutet diese Bemerkung von Roshani hin, denn viele seiner widerlichen Sprüche hätte Canonica coram publico gemacht. Reaktion: «In der Redaktion tat man trotzdem so, als wäre Canonica einfach nur ziemlich verquer. Als hätte er einen Spleen, mit dem man sich halt arrangieren müsse.»
Es scheint zumindest in der Redaktion des einstmals angesehenen «Magazin» eine toxische Unkultur geherrscht zu haben. Die Frage ist vor allem, wieso so viele auch männliche Mitarbeiter, die sich gegen aussen wortstark für die Sache der Frau und gegen Sexismus und Figuren wie Weinstein aussprechen, in der Reaktion feige die Schnauze gehalten haben.
Spannend wird auch zu beobachten sein, wie Tamedia um dieses Thema öffentlich herumeiern wird. Wetten, dass die Fürsorge des Arbeitgebers und der Persönlichkeitsschutz von Mitarbeitern leider jede offizielle Stellungnahme verhindern wird?
Dabei wäre es für die zahlenden Leser durchaus von Interesse, wie sich ein solch widerlicher Chefredaktor so lange halten konnte. Ob er wirklich Protektion von oben besass. Ob er Herrschaftswissen hatte, das ihn unantastbar machte. Wieso es ihn dann doch gelupft hat, am Schluss. Wieso auch Roshani – laut ihr ohne Begründung – gefeuert wurde. Wie sich das von ihr geschilderte Verhalten von Boselli, Rutishauser und der Tamedia-Führung mit deren Selbstdarstellung nach aussen verträgt.
Aber so gerne Tamedia auch bereit ist, vermeintliche oder echte Skandale anderswo aufzudecken, so verschlossen wie eine Auster ist das Haus, wenn es um den Dreck vor der eigenen Türe geht.
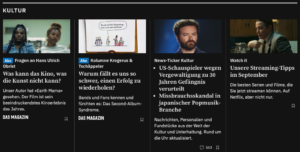 Das schämt sich auf der Homepage von Tamedia nicht, unter der Rubrik «Kultur» zu erscheinen. Im «Magazin» wurde ein Autor zu einem Kinoerlebnis befragt. Journalisten interviewen Journalisten, das ist immer das Begräbnis der Berichterstattung.
Das schämt sich auf der Homepage von Tamedia nicht, unter der Rubrik «Kultur» zu erscheinen. Im «Magazin» wurde ein Autor zu einem Kinoerlebnis befragt. Journalisten interviewen Journalisten, das ist immer das Begräbnis der Berichterstattung.















