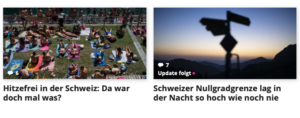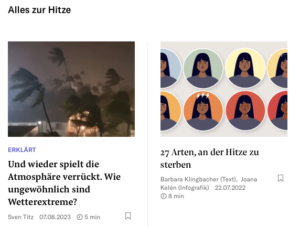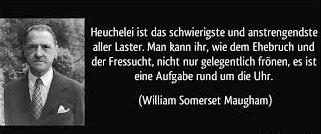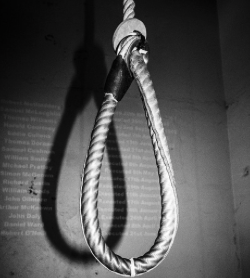Wenn zwei das Gleiche tun – zeigt sich das Niveau.
Zufälle gibt’s … Geht man nach der Chronologie, hatte die NZZ um wenige Stunden die Nase vorn:

Variationen zur Schweizer Geschichte, wenn sich entscheidende Ereignisse anders abgespielt hätten.

Variationen zur Schweizer Geschichte, wenn sich entscheidende Ereignisse anders abgespielt hätten. Oder sagten wir das schon?
Einmal NZZ, einmal Tamedia.


Hoppla. Nun ist es so, dass bei Tamedia der verantwortliche Redaktor Andreas Tobler heisst. Das sagt eigentlich schon alles. Der kennt einmal seine Grenzen und hat «Intellektuelle sowie renommierte Historikerinnen und Historiker gefragt …»
Die Resultate sind, gelinde gesagt, durchwachsen. Markus Somm macht sich Gedanken, wie’s weitergegangen wäre, hätte die Schweiz 1515 bei Marignano gewonnen. Ist durchaus unterhaltsam. Josef Lang, nein, muss man nicht lesen. Marco Jorio. Marco who? Brigitte Studer, emeritierte Geschichtsprofessorin, geht der Idee nach, dass das Frauenstimmrecht schon 1919 eingeführt worden sei. Historisch absurd, das macht die NZZ dann viel besser.
Und schliesslich der unsägliche Jakob Tanner, der eigentlich darüber fantasieren möchte, was wäre, wenn Hitler die Schweiz erobert hätte. Aber statt dem nachzugehen, ist er viel zu selbstverliebt und schreibt eigentlich nur über sich: «In meiner Mitte der 1980er-Jahre vorgelegten Dissertation … Um den analytischen Durchblick zu schärfen, zielte ich … Meine kontrafaktische Modellierung bezog sich auf die Frage … Dieses Nachdenken über «roads not taken» hat es mir erleichtert …». Geschichtsschreibung als Bespiegelung des eigenen Bauchnabels, lachhaft.
Eine Franziska Rogger (sieht sich als «Historikerin und Feministin») fantasiert darüber, dass das Frauenstimmrecht 1971 nicht eingeführt worden wäre und irrlichtert in die Zukunft: «2041 schliesslich kappte man in einer ausgleichenden Gerechtigkeit das männliche Stimmrecht, von nun an waren nur noch Frauen stimmberechtigt». Geschichte als Wahnvorstellung. Regula Bochsler (bezeichnet sich als «Historikerin, Künstlerin und TV-Journalistin») überlegt sich, was passiert wäre, wenn Christoph Blocher nicht die EMS Chemie übernommen hätte. Auch das macht die NZZ viel besser.
Und Moritz Leuenberger schliesslich leckt wie immer leicht weinerlich eine alte Wunde: «Bei einem Ja zum EWR hätte sich diese Spirale in die andere Richtung gedreht. Wir hätten ein unverkrampftes Verhältnis zur EU und wären nicht bis zur Verhandlungsunfähigkeit gelähmt und müssten ständig Unterhändlerinnen austauschen.» Wenn Wünschen helfen würde, wäre Leuenberger ein erfolgreicher Politiker gewesen.
Insgesamt eine naheliegende Idee zum 1. August, weitgehend versemmelt durch mediokres Personal. Also genau das, was Tamedia halt ist.
Die drei Autoren der NZZ hingegen sind selbst ans Gerät gegangen und haben durchaus niveauvolle alternative Szenarien entwickelt. Sie legen mit einem hübschen Nietzsche-Zitat schon gleich mal die Latte hoch: «Die Frage «Was wäre geschehen, wenn das oder das nicht eingetreten wäre» wird fast einstimmig abgelehnt, und doch ist sie gerade die kardinale Frage.»
Auch bei ihnen erobern 1940 die Nazis die Schweiz. Das wird aber nicht aus der Bauchnabelperspektive erzählt, sondern den wahren Geschehnissen entlang, angefangen bei der historischen Figur Hauptmann Menges, der den Auftrag erhalten hatte, einen Angriffsplan gegen die Schweiz auszuarbeiten. Die kontrafaktische Darstellung endet mit der Feststellung, dass sich die Historiker bis heute streiten, wieso Hitler den Angriffsbefehl nicht gab: «Was immer der Grund war: Die Neutralität ist bis heute identitätsstiftend für das Land. Die Zustimmung lag Anfang 2023 bei 91 Prozent.»
Viel näher an der Realität ist auch die Erzählung, dass Christoph Blocher nicht nur eine Lehre als Bauer gemacht hätte, sondern tatsächlich auch Bauer geworden wäre und deshalb keine Zeit gehabt hätte, in die SVP einzutreten, bzw. dort aktiv zu werden. An dem Tag, als er gewinnbringend eine Kuh verkauft, tritt die Schweiz 1992 dem EWR bei.
Eine weitere spannende Geschichtsumschreibung ist die Aufgabe des Schweizer Bankkundengeheimnisses bereits im Februar 1936 auf französischen Druck hin. Am Anfang steht eine Razzia in Paris, die tatsächlich stattgefunden hat und als «Pariser Skandal» in die Geschichte einging. Nächste interessante Etappe: wie wäre es weitergegangen, wenn die Schwarzenbach-Überfremdungsinitiative 1970 angenommen worden wäre.
Entlang der historischen Figur Antoinette Quinche entwickelt die NZZ ein realistisches Szenario, was passiert wäre, wenn nicht zuletzt aufgrund ihres Kampfes die Frauen 1931 das Stimmrecht bekommen hätten.
Darin sind so grossartige Trouvaillen wie Auszüge aus einer 136-seitigen Botschaft des Bundesrats zum Frauenstimmrecht aus dem Jahr 1957: «Das Denken der Frau lässt vielleicht hie und da an logischer Konsequenz vermissen … Wenn gesagt wird, die Frau gehöre ins Haus, so ist das sicher richtig. Nicht richtig wäre es aber, daraus zu schliessen, dass das Frauenstimmrecht abgelehnt werden müsse.»
Und schliesslich, auch viel sinnenhafter als ein Sieg bei Marignano, was wäre, wenn die Schweiz beim Wiener Kongress 1815 nicht als Pufferstaat wiederhergestellt worden wäre, sondern der Plan des Freiherr von Stein angenommen worden wäre, die Schweiz auf die Nachbarstaaten aufzuteilen. «Und weil die Kantone wenig verbindet, kommt es danach nie mehr zum Versuch, die alte Eidgenossenschaft wiederzubeleben. Die moderne Schweiz gibt es nie. Der Gotthard bildet heute die Grenze zwischen Deutschland und Italien.»
Die NZZ erinnert dann daran, wie es wirklich war: «1815 wurde in Wien die Grundlage für die moderne Schweiz geschaffen – und zwar hauptsächlich auf Initiative eines griechischen Diplomaten im Auftrag des russischen Zaren. Die Eidgenossen hatten wenig dazu beigetragen.»
Das sind Szenarien, die Spass machen und zum Denken anregen. Kompetent nahe an den wirklichen historischen Ereignissen entlanggeschrieben, wohldokumentiert und erkenntnisfördernd, statt Ideologien, Steckenpferde und persönliche Meinungen der Autoren zu bedienen.
Lustiger Zufall der Geschichte, und erst noch wahr, dass NZZ und Tamedia am gleichen Tag die gleiche Idee veröffentlichen. Was für ein Pech auch für den Konzern an der Werdstrasse, dass seine Mediokrität mal wieder so schmerzlich vorgeführt wird. Aber Redaktoren wie Tobler sind scham- und schmerzfrei, das hat er schon zur Genüge unter Beweis gestellt.
Dem Leser sei aber dieser Direktvergleich ans Herz gelegt, auch wenn er dafür einmal bei einem der beiden Blätter (oder gar bei beiden) einen Obolus entrichten muss. Das lohnt sich schon alleine wegen der Entscheidung, wofür man zukünftig Geld ausgeben will …