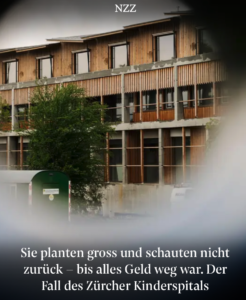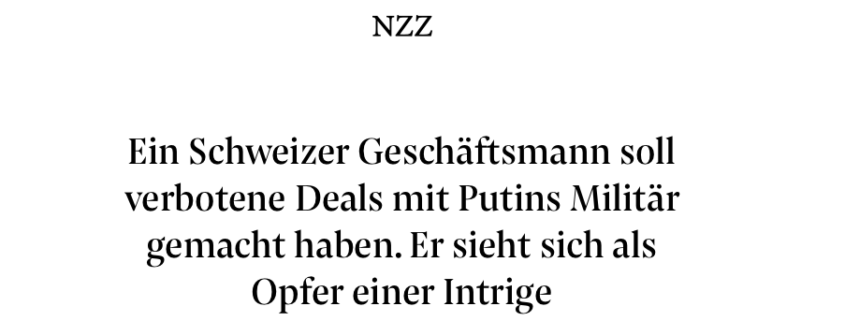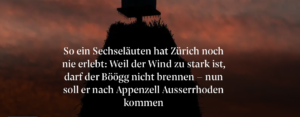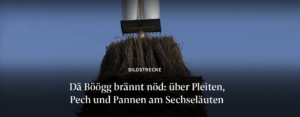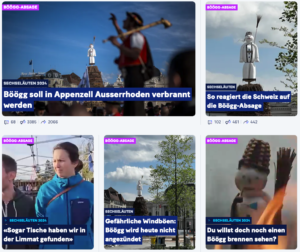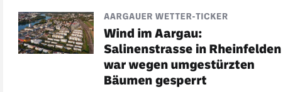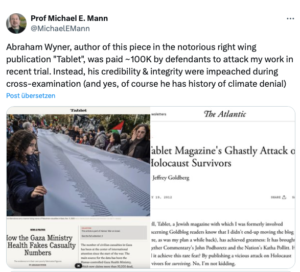So geht Lokaljournalismus
Was die «Republik» im Koma sieht, blüht auf.
Das Online-Organ der Hänger und Heuchler gibt Hirntotes von sich, schnitzt sich die Realität nach eigenem Gusto und behauptet, der Lokaljournalismus liege im Sterben.
Das Gegenteil ist der Fall. Gerade wieder einmal zeigt die NZZ, wie man ein herausragendes Beispiel von Lokaljournalismus inszeniert. «Sie solidarisieren sich mit Terroristen und hassen den Staat. Unterwegs in der Welt des Revolutionären Aufbaus», heisst das Stück online, mit dem Giorgio Scherrer, Fabian Baumgartner und Oliver Camenzind die Leserschaft auf den 1. Mai einstimmen.
Statt der üblichen Krawall-Berichterstattung im Nachhinein, statt der Zusammenfassung, wer dieses Jahr im Katz-und-Maus-Spiel zwischen Chaoten, Krawallanten und Polizei gewonnen hat, ist die NZZ tief in die Welt der Linksautonomen, der gewaltbereiten Mitglieder und Sympathisanten des RAZ eingetaucht.
Die Journalisten nahmen an einer Gerichtsverhandlung teil, deren Anlass zum Prusten wäre, wäre es nicht so absurd-traurig. Denn vor Gericht steht ein Rädelsführer, der am Rand einer friedlichen «Black Lives Matter»-Demonstration einem Polizisten mit voller Wucht eine Fahnenstange auf den Kopf geschlagen haben soll. Ausgerechnet dem einzigen schwarzen Ordnungshüter …
Aber solche Absurditäten sind in dieser hermetisch von der Realität abgekapselten Ingroup nötige Aktionen gegen das Schweinesystem. Oder wie ein ehemaliger Sympathisant sagt: die würden jeden 1. Mai glauben, dass nun die Revolution ausbräche, dass sich revolutionäre Kräfte die Strasse erobert hätten, dass dem unmenschlichen Ausbeutungssystem schwere Schläge versetzt würden.
Die Journalisten haben auch einschlägige Webseiten besucht und summieren:
«Im ganz Grossen geht alles andere unter: Das ist das Prinzip, nach dem die Zürcher Linksextremen operieren.
Das ganz Grosse, das ist der Kampf gegen das «System», gegen den Kapitalismus und den «bürgerlichen Staat». Was das heisst, ist auf der Website festgehalten: Es brauche eine neue Gesellschaft, in der nicht mehr alle menschlichen Interessen, Bedürfnisse und Beziehungen gnadenlos einer Logik des Kapitals unterworfen würden. Für diesen Kampf ist jedes Mittel recht. Und wenn sich die Autonomen die Strasse nehmen, dann endet es häufig mit Gewalt und Krawall.»
Wobei Katz-und-Maus-Spiel eine unerlaubte Verniedlichung ist: «Am 12. Mai 2023 versuchen Vermummte, eine brennende Fackel durch die offene Tür eines Fahrzeugs zu werfen, in dem mehrere Polizistinnen und Polizisten sitzen. Der Stadtrat schreibt später als Antwort auf einen Vorstoss im Parlament, der Mob habe mit dem Angriff inklusive 2000 Grad heisser Fackel den Tod der Einsatzkräfte in Kauf genommen.»
So durchleuchtet die NZZ diese verschlossene Welt von hirntoten Fanatikern, die in jeder Gegenwehr der Staatsmacht gegen ihre Aktionen einen weiteren Beweis dafür sehen, dass das System brutal unterdrückt und durch seine Repression zeige, wie gefährlich ihre Aktionen seien.
Dabei kommen sie seit Jahren nicht aus ihrem Gesinnungsghetto heraus, wo ein harter Kern von ein paar Dutzend Mitgliedern von ein paar hundert Sympathisanten umschwirrt wird. Wie die sich die Welt zurechterklären, das beschreibt die NZZ hervorragend.
Belustigend dabei ist, dass die NZZ noch vor 40 Jahren in leicht hysterischen Tönen vor dem umstürzlerischen Potenzial solcher Gruppierungen gewarnt und in ihnen den verlängerten Arm Moskaus gesehen hätte. Heutzutage nimmt es die alte Tante mit viel mehr Gelassenheit; schliesslich hat sich das von ihr verkörperte kapitalistische Ausbeutersystem als zäher erwiesen als seine kommunistische Alternative im Ostblock.
Während man die Beschreibung der sich selbst in einem Zerrspiegelkabinett der zurechtgebüschelten Realität verlierenden Gedankengänge der Linksradikalen liest, drängt sich die Ähnlichkeit zum Ingroup-Selbstbestätigungsjournalismus der «Republik» auf. Auch hier steht vor dem Artikel die These, weiss der Schreiber schon ganz genau, was das Ergebnis seiner Recherche sein wird, bevor er sie überhaupt begonnen hat. Von den angekündigten «Expeditionen in die Wirklichkeit» sind nur Ausflüge in die eigene Weinerlichkeit übrig geblieben, zur Selbstbestätigung des Autors und der immer kleiner werdenden Leserschar.
Aber das Sendungsbewusstsein, die Gesellschaft, die Demokratie, die Welt retten zu müssen, die ist überall die gleiche.