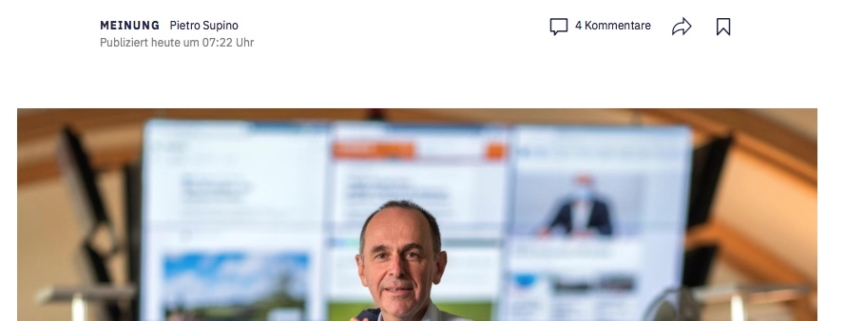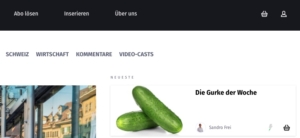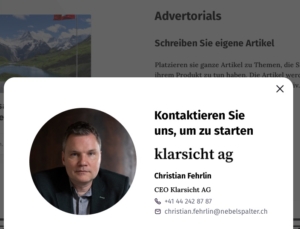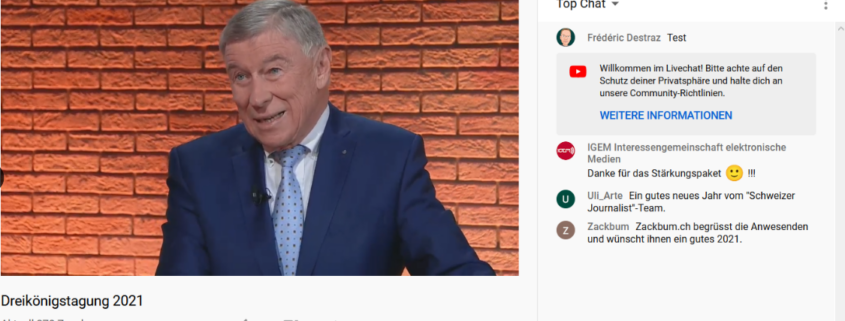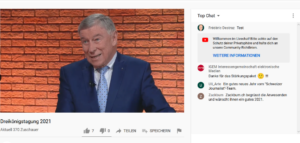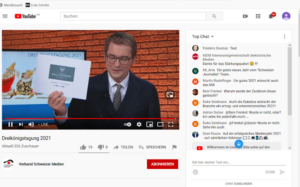Hier spricht der Chäf
Tamedia: hier zählt die Meinung. Zuerst die von Pietro Supino. Von wem denn sonst?
Leichter Bauchansatz. Ansonsten locker im Auftritt; Newsroom, Jackett am Finger über den Rücken gehängt. Leicht zerknitterte Hose, blassblaues Hemd, immerhin Manschettenknöpfe. Keine Krawatte, kein sichtbares Monogramm zum Signalisieren: massgeschneidert.
Das ist mal ein Chef als Kumpel, der Mund zum Ansatz eines Lächelns leicht geöffnet. In dieser Haltung entscheidet Pietro Supino sicherlich auch jeweils über die nächste Entlassungswelle. Und beauftragt Corporate Communication, mal wieder das faule Ei, das er gelegt hat, golden anzumalen und mit Schleifchen zu dekorieren («schmerzlich, aber für die mittelfristige, Synergien, noch mehr als zuvor, Qualität, Vertrauen, Blüblü»).
Nun geht’s aber mal wieder um alles, also um: «Die Politik ist gefordert, die Pressefreiheit zu bewahren», behauptet der Verleger, VR-Präsident der TX Group, Oberboss von Tamedia und das Mitglied des Coninx-Clans. Gerade rumpelt der Beschluss, Schweizer Medien noch mehr Steuergelder reinzuschaufeln, durch die beiden Parlamentskammern. Höchste Zeit, findet Supino, in diesem Umfeld noch seinen Senf zu geben; bzw. geben zu lassen. Also griffen die Sprachkünstler in die Harfe und lassen engelsgleiche Töne sprudeln:
«Freie und unabhängig Medien sind für eine Demokratie unerlässlich, vor allem für eine direkte Demokratie, wie wir sie in der Schweiz pflegen.»
Zustimmend eine andere Grösse zu zitieren, das kommt auch immer gut: «Medien sind Weltbilderzeuger, wie es der Präsident der Eidgenössischen Medienkommission Otfried Jarren auf den Punkt bringt. Man könnte auch sagen Marktplätze, die zwischen Bürgern, Politik, Wirtschaft und Kultur vermitteln.»
Fast. Ehrlicher wäre gewesen: Man könnte auch sagen Marktplätze, die das Privatvermögen des Coninx-Clans mehren.
Weiter auf der Schleimspur: «… besondere Verantwortung verbunden … strengen Massstab an unsere Arbeit ansetzen … Erfüllung unseres medienethischen Anspruchs … unsere Glaubwürdigkeit ist unser grösstes Kapital.»
Wenn Tartuffe spricht …
Man leidet mit den armen Schweinen, die so was formulieren müssen und sich dann nicht mal den Finger in den Hals stecken müssen, um sich zu entleeren. So lässt also der nur an der Mehrung des Profits seines Clans interessierte Supino schwurbeln. Will er also der Verabschiedung weitere Millionenfüllhörner, die sich über die Schweizer Medien ergiessen werden, noch den letzten Schub geben? Aber nein, er weiss, dass da die Lobbyarbeit und die Abhängigkeit der Politik vom Transmissionsriemen Medien wie geschmiert funktioniert.
Nein, er will auf zwei weitere Themen hinweisen. Mit der vermeintlich harmlosen Streichung des Wörtchens «besonders» soll die Hürde für das präventive Verbot von Publikationen niedrigergelegt werden. Und der Ständerat will nichts daran ändern, dass das Öffentlichkeitsgesetz zwar den Zugang zu Behördenakten erleichtert, die aber mit prohibitiven Gebühren für das Erstellen eines verlangten Dossiers die journalistische Arbeit bewusst torpedieren.
Beides muss geändert, bzw. verhindert werden. In dieser Ansicht kann man Supino nur mit vollem Herzen, beiden Händen und aller Stimmkraft zustimmen. Dass für ihn aber journalistische Arbeit letztlich eine quantité negligable ist, zweitrangig, wenn es um klare Profitziele, um eine Segmentierung des Konzerns geht, wo jede Einheit unabhängig von der anderen das Vermögen der Familie Coninx mehren soll, das ist die andere, hässliche Seite der Medaille.
Dem alten Schlachtross Tagi sind Stellen-, Immobilien- und Fahrzeuganzeigen ins Internet abgeschwirrt und es wäre mehr als naheliegend, die dort erzielten Gewinne wernigstens teilweise in den Tagi zu stecken? Keine Quersubventionierung, dekretiert Supino, wenn der Tagi nicht rentiert, dann wird halt solange abgespitzt, bis sich das ändert.

Das grosse Vorbild. Nora Zukker, das war …
«Verantwortung, medienethischer Anspruch»? «Glaubwürdigkeit als grösstes Kapital»? Nein, Yacht, Auto, Villa, Kunstsammlung. Wer einen solchen Tartuffe als Chef hat, muss sich um seine Glaubwürdigkeit keine Gedanken machen. Sie ist nicht erkennbar.