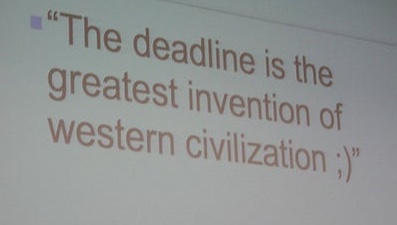Die grosse Medienlüge
Wieso geht ein Befürworter des Medienpakets mit 75 Prozent Gegenstimmen unter?
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Es ist keine schlechte Art, die Temperatur der Stimmbürger zu messen. Seit einiger Zeit veranstaltet der «Blick» Streitgespräche. Ein Exponent ist dafür, einer dagegen. Moderierter Schlagabtausch, dann Abstimmung unter den Lesern. Der Gewinner bekommt ein Gratisinserat für seine Sache im «Blick».
Normalerweise ist der Ausgang eher knapp, schon ein 60 zu 40 ist Anlass zu Geraune. Nun ging aber im Disput zwischen Matthias Aebischer (NR SP, für das Medienpakets) und Peter Weigelt (alt NR FDP, dagegen) der Befürworter dramatisch unter. 75 Prozent stimmten gegen die Subventionsmilliarde.
Dabei tut auch der «Blick» alles, seinen Lesern ein Ja schmackhaft zu machen. Der Ringier-Verlag in der Person von Marc Walder tut hingegen alles dagegen. Auf seinen Spuren wandelt Pietro Supino, der aus Verzweiflung in seinen Tamedia-Blättern das Wort ergreift und länger nicht mehr loslässt. Als weiteren Beitrag zur strikten Trennung von Verlag und Redaktion.
Aber das eigentliche Problem der Befürworter ist nicht die völlig verunglückte Tell-Werbekampagne. Es sind auch nicht Unterstützer wie Hansi Voigt oder Jolanda Spiess-Hegglin, die schon alleine für 10 Prozent mehr Neinstimmen sorgen.
Es sind auch nicht Linke und Grüne, die plötzlich ihre Liebe zu den Portemonnaies der reichen Medienclans entdeckt haben. Und es sind auch nicht die «Verleger» der «Republik», die in aller kritischen Unabhängigkeit zu 90 Prozent für Staatskohle sind.
Das Problem ist die offenkundige Verlogenheit
Es ist die offenkundige Verlogenheit der Befürworter, die dem Publikum sauer aufstösst. Grossverlage, die satte Gewinne machen, Sonderdividenden ausschütten und alleine durch das Zusammenlegen ihrer Handelsplattformen um Milliarden reicher werden: wie sollen die glaubhaft machen, dass sie dringend Steuergelder brauchen, um nicht der Suppenküche anheim zu fallen?
Wer seinem Stammblatt den Stellen-, Immobilien- und Autoanzeiger wegnimmt, ins Internet verschiebt und sich weiterhin damit krumm verdient, vom Stammblatt aber fordert, dass es gefälligst selbst die Gewinnvorgabe erfüllen solle, Quersubventionen gebe es nicht, ist dermassen unglaubwürdig, dass er eigentlich ständig gegen Türen und Scheiben stossen müsste, weil seine Nase so lang geworden ist.

Wenn ein Unternehmen sein ursprüngliches Stammgeschäft von allen Profitbringern entkleidet, es anschliessend skelettiert, ins Koma spart, dünne Einheitssuppe in kleinen Schälchen serviert, dafür aber unverschämte Preise verlangt, wer soll da einsehen, dass ein solches Geschäftsmodell unbedingt eine Milliarde Steuergelder zusätzlich braucht?
Normal ist seit vielen Jahren, dass man mehr für weniger bekommt. Mehr Computer, mehr Handy, mehr Produkt, mehr Leistung. Für weniger Geld. Im Medienbereich ist’s umgekehrt.
Unglaubwürdiges Gejammer
Man kann dem Volk, den Stimmbürgern schon mal ein X für ein U vormachen. Man kann unermüdlich Vierte Gewalt, Kontrollfunktion, gar Rettung der Demokratie orgeln. Man kann mit trauriger Miene von bald bevorstehenden roten Zahlen jammern.
Wenn man dann in das von Weinreben umgebene Schloss zurückkehrt, den Aston Martin besteigt, auf der Privatyacht durch die Karibik schippert, dann wirkt das etwas unglaubwürdig.
Man kann von Meinungspluralismus schwärmen, die Bedeutung des Lokalen loben, die Meinungsvielfalt hochleben lassen. Und die Unabhängigkeit der Redaktion beschwören. Wenn man dann Jubelchöre das hohe Lied der staatshörigen Unterstützung singen lässt, die Redaktoren völlig unabhängig sich für ein Ja die Finger wundschreiben, wenn es nur Meinungseinfalt, Monothemen, offenkundig von Weisungen abhängige Redaktionen gibt, das Lokale zuerst krank-, dann totgespart wird, steht man nackter da als der Kaiser in seinen neuen Kleidern.
Es wird gejammert, dass es einen Paradigmenwechsel gebe, neue Technologien, das Internet, digital, interaktiv, neu. Da brauche man Hilfe bei der Transition, beim Wechsel, wer habe denn schon vorhersehen können, dass zwei Internetgiganten beim Online-Marketing 90 Prozent des Werbekuchens abräumen. Da brauche man Hilfe, das könne man alleine nicht stemmen.

Sagen die multimillionenschweren Verlegerclans. Statt ihre Kunstsammlungen zu verkaufen oder ihre überquellenden Schatullen zu öffnen. Statt es so wie René Schuhmacher zu machen. Der hat 30 Jahre lang den grössten Teil seiner Gewinne reinvestiert, betreibt Magazine mit hohem Nutz- und Gebrauchswert. Verzichtet daher auf seinen Anteil an Staatsmillionen und ist gegen das Medienpaket.
Für dumm verkaufen wollen
Diese Haltung stünde den Coninx-Supino, Ringier-Walder, Wanner-Wanner und Lebrument-Lebrument auch gut an. Dann könnte man vielleicht sogar über punktuelle Hilfen reden. Aber nur, wenn mit den explodierenden Gewinnen keine Sonderdividenden ausgerichtet werden, gell Tamdia?
Denn noch schlimmer als verlogene Heuchelei ist nur eins.
Selber so dumm sein, dass man meint, der Stimmbürger würde sich so leicht für dumm verkaufen lassen.