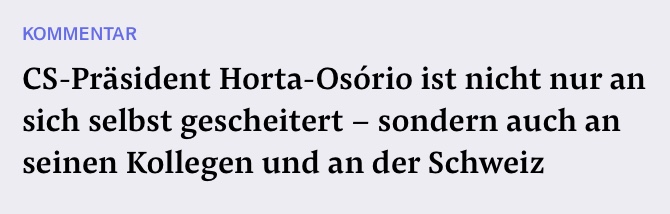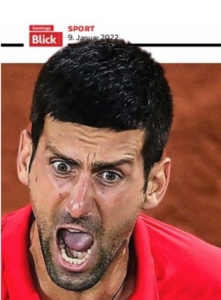Kann die NZZ Krise?
Falkenstrasse Open: Wer gewinnt, die NZZ oder das CS-Schlamassel?
Nehmen wir es mal sportlich. Früher hätte ein rauchender Journalist in den Telefonhörer geschrien: haltet die Druckmaschinen an, es gibt News. Dann hätte er die neusten Entwicklungen bei der Credit Suisse in die Maschine gehämmert, während ein Bote sofort jedes Blatt zum Setzer gebracht hätte.
Heute geht es viel digitaler und ruhiger zu. Aber dennoch ist es sportlich: Was liefert das Haushofblatt der Finanzwelt in den zwei Tagen nach dem Rücktritt des VR-Präsidenten der zweitgrössten Schweizer Bank?
Quiet please, Aufschlag CS. Trockene Medienmitteilung, Return NZZ. Die alte Tante spielt über fünf Sätze, also mit fünf Artikeln auf.

Darin ist mal alles, was man so braucht. Ein mehrmals aktualisierter Artikel, der das Faktische beschreibt: «Credit-Suisse: Nach seinen Quarantäneverstössen muss Präsident Horta-Osório gehen».
Darin kommentarlos der kühle Dank: «Vizepräsident Schwan verabschiedete seinen Präsidenten im Communiqué denn auch nur kurz und bündig mit einem einzigen Satz: «Wir respektieren António Horta-Osórios Entscheidung und sind ihm für seine Führungsrolle bei der Festlegung der neuen Strategie, welche wir über die nächsten Monate und Jahre weiter umsetzen werden, zu Dank verpflichtet.»»
Sec, trocken, technisch nicht brillant, aber solide Rückhand.
Natürlich darf auch ein Stück Spekulationen über Hintergründe nicht fehlen.Mit lockerem Spielbein geht’s weiter: «Horta-Osórios Abgang bei der Credit Suisse: Geht es um die gebrochene Quarantäne oder um mehr?»
Das ehrwürdige Blatt wird sogar leise witzig:
«Ob die Präsidentschaft des Portugiesen wegen oder mit Verstössen gegen die Corona-Regeln zu Ende gegangen ist, bleibt umstritten.»

Leichter Volley mit Anspielung auf das Problem, dass es nicht möglich ist zu unterscheiden, ob ein Patient wegen oder mit Corona ins Spital eingeliefert wird.
Die NZZ kann auch mal ziemlich böse werden
Dann kommt ein Zweihänder zum Einsatz: «Die Credit Suisse lässt kaum einen Skandal aus – eine Übersicht der Turbulenzen der letzten Jahre».
Diese Schärfe wird verständlich, wenn man das Ausmass der Flops, Bussen und des ständigen Krebsgangs des Aktienkurses verfolgt:
«Die Schweizer Grossbank durchlebt die turbulentesten Jahre seit der Finanzkrise. Sie stolpert seit Jahren von einem Skandal in den nächsten. Strategische Fehler und Missmanagement werden offenkundig.»
Den letzten Aufschlag hat natürlich der Kommentar, vom Wirtschaftschef Chanchal Biswas höchstpersönlich.

Leider merkt man hier, dass der Trainer, bzw. ein Korrektiv fehlt. Denn dieser leicht eiernde Kommentar ist das Schwächste am ganzen Spiel. Biswas meint, es sei doch ein nettes Leitmotiv, so anzufangen:
«Wenige Stunden nach Novak Djokovic hat es auch António Horta-Osório erwischt.»
Und es durchzuziehen: «Horta-Osorio wurde zum Verhängnis, dass er – wie Djokovic auch – den Eindruck machte, er stehe über dem Recht.»
Das stimmt nun im Falle von Djokovic eindeutig nicht, das wäre dann klar Ball im Netz. Auch die Schlussfdolgerungen schaffen es nicht über die obere Netzkante:
«In einer Credit Suisse, die zwar stabile, aber eher tiefere Renditen erwirtschaftet, winken auch geringere Löhne und Boni.» Daher vermutet der Wirtschaftschef die Heckenschützen in der Abteilung Investmentbanking:
«Es dürften diese Kreise gewesen sein, welche die Regelverstösse von Horta-Osório ans Licht der Öffentlichkeit brachten und auch gezielt einen Keil zwischen den Präsidenten und Konzernchef Thomas Gottstein zu treiben versuchten.»

Mag sein, kann sein, muss nicht sein. Schliesslich entlässt er den neuen VRP (und den Leser) mit zwei offenen Fragen, die eigentlich keinen Kommentar darstellen, sondern Ausdruck von Hilflosigkeit sind:
«Wie stellt er sicher, dass alle in der Bank am gleichen Strick ziehen? Und vor allem: Sind alle Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung die richtigen Leute dafür?»
Diese Frage kann man sich bezüglich Führungsetage Wirtschaft bei der NZZ auch stellen …