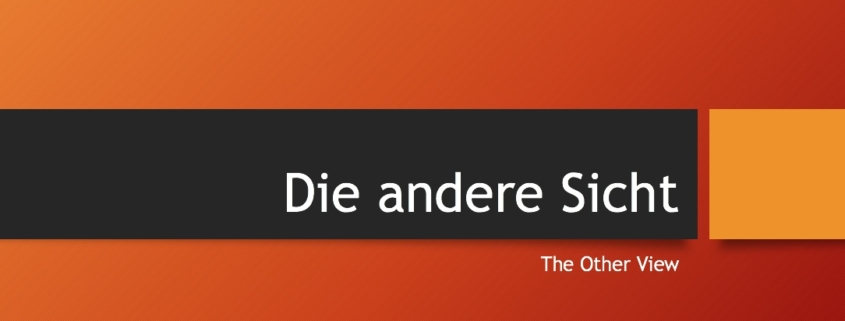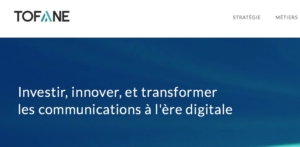Alternative Bürgerjournalismus
Von der Vielfalt zum Einheitsbrei: Gibt’s einen Ausweg?
Von Felix Abt
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Vor etlichen Jahrzehnten habe ich in Personalkantinen gegessen, wo jeden Tag ein immer gleich schmeckender Einheitsbrei serviert wurde, sozusagen mit Firmenstallgeruch. Dagegen boten die Medien damals ein tägliches Menu mit Vielfältigem, Informativem, Interessantem sowie Reportagen und Analysen mit Tiefgang an. Inzwischen hat sich das umgekehrt: Personalkantinen haben sich zu Personalrestaurants gemausert, wo vielfältiges, schmackhaftes Essen, zubereitet von Köchen, die auch über Kompetenz in gesunder Ernährung verfügen, angeboten wird.
Die damals unzähligen Medien wurden seither sowohl weltweit wie auch in der Schweiz, grossmehrheitlich von Konzernen aufgekauft, womit die Vielfalt zur Einfalt schrumpfte, und die grosszügige Medienmenükarte auf den Einheitsbrei mit Konzernstallgeruch reduziert wurde. Begleitet war die Medienkonzentration mit dem Zusammenlegen von Redaktionen, dem Ausdünnen des Korrespondentennetzes, dem Abbau vieler Journalistenstellen und dem Einstellen, billigerer, weniger qualifizierten Medienschaffenden.
Als es obligatorisch war, die NZZ zu lesen
In der Prä-Einheitsbreiperiode war es fast ein «Muss», die NZZ zu lesen, wo journalistische Riesen wie zum Beispiel ein Ernst Kux die Sowjetunion und China haarscharf beobachtete, abklopfte und erklärte, oder der mit dem Markenzeichen (H.A.) berühmt gewordene Hansjörg Abt unerschrocken und tief hinter die Wirtschaftskulissen guckte und Skandale enthüllte, oder ein Arnold Hottinger, der den Nahen Osten so gut kannte und so gut verständlich machte wie kein zweiter Journalist im deutschen Sprachraum. Inzwischen sind alle Riesen abgetreten und haben den journalistischen Zwergen Platz gemacht. Das bedeutet, dass es heute eigentlich keinen Unterschied mehr macht, ob man die NZZ noch liest oder nicht.

Journalist Arnold Hottinger †.
Als jemand, der aus geschäftlichen Gründen viel auf der Welt herumgekommen ist, habe ich auch etliche Medien aus dem anglosächsischen, lateinamerikanischen und asiatischen Raum in Flugzeugen und Hotels konsumiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass deutschsprachige Medien meist nur ein Abklatsch amerikanischer und englischer Medien waren, wenn es um internationale Nachrichten und Reportagen ging. Weil die Originale halt immer noch wesentlich besser sind als die ausgedünnten, deutschsprachigen Billigkopien, zog ich es vor, mehr englischsprachige Medien zu konsumieren.
Die weltweit profitorientierte Verlagerung von Familieneigentum zu börsennotierten Medienkonzernen hat natürlich zu einem schamlosen Wettlauf weg von journalistischen Spitzenleistungen geführt. Wie können Nachrichten – ob innerhalt oder ausserhalb der Vereinigten Staaten – gedeihen, wenn NBC 500 Millionen Dollar für die Übertragungsrechte der National Football League ausgibt?
Die Massenmedien schaden sich selbst
Klick-ködernde Massenmedien haben sich auch geschadet, indem sie immer mehr Meinungen und Fakten vermischten, oder haben ihre Glaubwürdigkeit verloren wegen ihrer forschen Parteinahme in politischen Angelegenheiten. So haben sich die amerikanischen Medien bei den Präsidentschaftswahlen 2016 fast unisono, massiv und unverschämt für die Kandidatin Hillary Clinton und gegen Donald Trump als Kampagnenhelfer engagiert. Was immer man auch von Trump halten mag, der Mangel an objektiver und fairer Berichterstattung hat selbst Trumpkritiker schockiert.
Nicht nur die NZZ hatte mal journalistische Riesen, auch andere renommierte Zeitungen, wie zum Beispiel die «New York Times». Chris Hedges war so einer, wegen dem das Blatt sogar einen Pulitzer Preis gewann. Er arbeitete für die «Times» während 15 Jahren als Korrespondent, gut qualifiziert mit fliessendem Spanisch in Südamerika und mit fliessendem Arabisch im Nahen Osten. Als er sich kritisch zu Amerikas illegalem Irakkrieg äusserte, wurde er von der «Times», einer Echokammer der U.S. Regierung und einer Kriegs-Cheerleaderin, einfach rausgeschmissen. Zwar «geächtet» von den Corporate Media, aber stets brillant, blieb ihm nichts anderes übrig, als für wesentlich weniger bekannte Medien tätig zu sein. Sein neuster Artikel «Waltzing to Armageddon» ist eine intelligente Analyse des aktuellen Kriegsgeschreis, wo er darlegt, warum und wie es unverhofft in eine Katastrophe epischen Ausmasses umschlagen kann. Natürlich sind derartige Gedanken bei den Kriegstrommlern in der Politik und den Medien, die gegenwärtig auf einer Flutwelle reiten, verpönt.

Journalist Chris Hedges.
Staatliche Medien können das Vakuum nicht füllen und bedienen sich auch zweifelhafter journalistischer Methoden. BBC-Starjournalist John Sweeney beispielsweise legte englische Universitätstudenten herein, und reiste mit ihnen als falscher «Universitätsprofessor» nach Pjöngjang, um dort einen Dokumentarfilm zu drehen. Mehr gesehen als jeder andere am Händchen geführte Tourist hatte er dabei nicht. Immerhin konnte er ein paar graue Häuserfassaden und drei Meter hohe Mauern filmen, als Beweis für die schrecklichen Dramen, welche sich tagtäglich dahinter abspielen unter der brutalen nordkoreanischen Diktatur. Er filmte auch einige der vielen Propagandaposter, um zu beweisen, wie arme Nordkoreaner mit einer wahnsinnigen Hirnwäsche tagtäglich drangsaliert würden. Die vielen Nordkoreaner, die ich kannte, haben die Propagandaposter kaum zur Kenntnis genommen.

Journalist John Sweeney.
Da es immer weniger Auslandsbüros und feste Auslandskorrespondenten gibt und andere traditionelle Methoden des Fallschirmjournalismus bei der Berichterstattung schwieriger Themen nicht effektiv sind, können Bürgerjournalisten eine Lücke füllen und die Öffentlichkeit besser über Nachrichten und Hintergründe aus aller Welt informieren.
Bürgerjournalismus aus China
Als einer, der sich seit Jahrzehnten mit China beschäftigt und das Land auch unzählige Male besuchte, wollte ich wissen, was hinter der äusserst schwerwiegenden Anschuldigung der amerikanischen Regierung und westlicher Medien steckt, welche von einem Genozid der Muslime in der chinesischen Provinz Xinjiang reden. Ich habe deshalb Ausländer, insbesondere Amerikaner, die fliessend Chinesisch sprechen und Xinjiang öfters besuchen, kontaktiert. Die meisten haben Videoaufnahmen gemacht, einige sogar mit versteckter Kamera. Anders als wenn BBC oder CNN mit ihren Kamerateams vor Ort aufmarschieren und lokale Behörden und Bevölkerung nervös machen, weil sie mit deren Intentionen («China bashing») vertraut sind, können sich nicht journalistisch tätige Ausländer dort frei bewegen und mehr oder weniger filmen, was sie wollen. Das Resultat meiner Recherchen ist hier publiziert.

Als Abraham Zapruder mit seiner Amateurkamera beschloss, den Besuch von John F. Kennedy 1963 in Dallas zu filmen, nahm er unbeabsichtigt Bilder von dessen Ermordung auf, die als Vorläufer des Bürgerjournalismus betrachtet werden können.
Bürgerjournalisten ohne formelle journalistische Ausbildung sind nicht notwendigerweise weniger objektiv und weniger fair als professionelle Journalisten. Deren Berichterstattung ermöglicht ausserdem das Erzählen von Geschichten und persönlichen Erfahrungen, deren Zeugnis eine neue Dimension bietet.