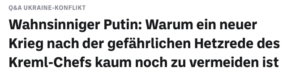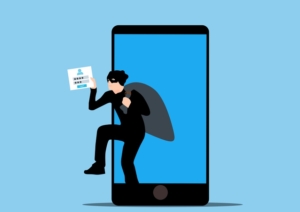Die Ballon-Geheimnisse
Pumpen, bis er platzt: das Prinzip aller Leaks, Papers und nun Secrets.
Die Trompetentöne erinnern immer an Jericho: Die Credit Suisse sei ein «Geldspeicher für korrupte Politiker, verurteilte Betrüger und mutmaßliche Folterknechte.»
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Und gleich nochmal,weil’s so schrecklich ist:
«Die internen Aufzeichnungen aus der Bank belegen, dass die Credit Suisse über Jahrzehnte und über den gesamten Erdball hinweg brutalen Machthabern, korrupten Politikern, Kriegsverbrechern und anderen Kriminellen Zugang zu blickdichten Schweizer Konten ermöglicht hat, auf denen diese ihren teils illegitimen Reichtum sicher parken konnten.»
Wussten wir doch. Skrupellose Schweizer Gnome, ihre geldigierige Amoral hinter biederem Aussehen verbergend. Dabei tropft aus den Safes in den tiefen Kellern der Bahnhofstrasse jede Nacht Blut, erschrecken die Nachtwächter, wenn wieder mal die Schreie von Folteropfern aus Schliessfächern quellen.
Es ist und bleibt eine verdammte Sauerei, das ist die Message, die Schweizer Banken, zumindest die Credit Suisse, haben nichts gelernt; alle Versuche, das Aufbewahren von Geldern aus krimineller oder ungeklärter Herkunft zu unterbinden, waren umsonst, selbst der Automatische Informationsaustausch nützt nicht wirklich.

Geldwäschereigesetz, «besondere Sorfaltspflichten», PEP (politically exposed persons), alles Show. Dahinter sitzt immer noch der ethikbefreite Schweizer Banker in ehrwürdig getäfelten Räumen, serviert Sprüngli und ist servil zu Diensten, wenn ihm grössere Summen anvertraut werden. Seine Flexibiltät wächst mit der Anzahl Nullen. Sieben sind schon mal gut, acht ist fantastisch, und wird sogar das Wort Milliarde in den Raum gestellt, wäre er auch bereit, seine Krawatte zu lockern und auf dem Tisch Salsa zu tanzen.
Weltweit wird über den Finanzplatz Schweiz abgeledert
Die Empörung weltweit ist gross. Stellvertretend dafür darf Nobelpreisträger Joseph Stiglitz abledern: «Zugleich sollten sich Länder wie die Schweiz dafür schämen, dass sie einen Rechtsrahmen geschaffen haben, der solch ein System gedeihen lässt.»
Immerhin fügt er am Schluss, nachdem er sich ausführlich über die Schweiz erregt hat, hinzu: «Wie viele Geschichten, wie viele Enthüllungen wird es noch brauchen, bis die Schweiz, die USA, das Vereinigte Königreich und andere Länder ihre Gesetze zum Bank- und Immobiliengeheimnis und zu all den anderen Aktivitäten ändern, die Geldwäsche erleichtern und Verbrechen und Korruption fördern?»
In seiner Philippika entgeht ihm hier aber ein nicht unwichtiges Detail: Fast alle Offshore-Finanzplätze der Welt wurden von Skandalen erschüttert, die auf gestohlenen Kundendateien beruhten. Panama, Singapur, fast alle kleinen karibischen oder pazifischen Inseln. Und immer wieder die Schweiz in Sachen Steuerhinterziehung. Oder Beihilfe zum Verstecken von Blutgeldern. Nun noch selbst dabei erwischt, mit blutigen Händen in diesem Sud zu rühren.

Aber: Es gibt keine einzige Enthüllung über die beiden anderen von Stiglitz aufgeführten Geldparadiese. Man kann es nicht oft genug sagen: In den USA stehen die grössten Geldwaschmaschinen der Welt, die lateinamerikanische Drogenmafia regelt dort ihren Finanzhaushalt. In diversen Bundesstaaten kann man bis heute Briefkastenfirmen gründen, ohne dass der Benficial Owner, der wirtschaftlich Berechtigte, angegeben werden muss. Dicht gefolgt werden die USA von Grossbritannien. Deutschland und Frankreich sind die Geldwäschereiparadiese in Europa. Holland ermöglicht es transnationalen Monstern, weitgehend steuerfrei davonzukommen. In der EU wurden bislang alle Versuche, mehr Transparenz bei Holdingstrukturen und Finanzvehikeln zu schaffen, abgeschmettert.
Es ist ein Konkurrenzkampf der Finanzplätze
Das heisst nun nicht: die auch, wieso dann wir nicht. Das heisst aber eindeutig: auch hier herrscht Konkurrenzkampf unter den grossen Geldanlagetöpfen. Und da spielen neben den Grossmächten USA und Grossbritannien eben Zwerge wie Panama, Singapur oder die Schweiz eine herausragende Rolle. So ist die Eidgenossenschaft immer noch die grösste Vermögensverwalterin der Welt.
Trotz allen bisherigen Attacken mittels gestohlener Kundendaten hat sich daran (noch) nichts grundlegend geändert. Ausser der ungebrochenen Lust der Medien, immer wieder einen Riesenballon aufzupumpen.
Diesmal handelt es sich offenbar um Angaben zu rund 30’000 Kunden der CS. Deren Konten wurden bis zurück in die 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts eröffnet; laut CS sind 90 Prozent bereits geschlossen oder im Prozess der Schliessung.

Abgesehen von vielen venezolanischen Mitgliedern der korrupten Führungsclique des Landes sind mal wieder erstaunlich wenig wirklich schlimme Finger unter den bislang veröffentlichten Kontobesitzern. Die CS hat weltweit rund 2 Millionen Kunden. Angenommen, bei allen 30’000 CS-Benützern handle es sich um ausgemacht Schweinebacken. Das wären dann 1,5 Prozent. Realistischer dürfet wohl sein, nach den sehr spärlichen Angaben über einzelne Personen, zu denen auch die üblichen Potentaten und Könige gehören, bei denen die illegale Herkunft der Gelder noch zu beweisen wäre, gehen wir vielleicht eher und grosszügig von 3000 aus. Das wären dann 0,15 Prozent.
Nun ist Vermutung und Nachweis in einem Rechtsstaat noch nicht das Gleiche. Nehmen wir also an, am Schluss, das wären aber viele im Vergleich zu den vorherigen «Enthüllungen», bleiben 300 verurteilte Straftäter übrig. Womit wir bei 0,015 Prozent wären.
Nicht signifikanter Bodensatz
Einen solchen Prozentsatz kann man mit Fug und Recht als nicht signifikant bezeichnen. Als fast unvermeidlichen Toleranzfehler. Als Bodensatz, der in jeder Bank ans Tageslicht gespült werden könnte, wenn man deren Kunden bis in die 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurückverfolgt. Denn zu diesen Zeiten musste zum Beispiel auch Al Capone, der Duce oder Adolf Hitler ihren Finanzhaushalt irgendwo regeln.
Und welche Bank in der Schweiz hätte dem Ehrendoktor der Universität Lausanne verweigert, ein Konto zu eröffnen?
Es ist vorhersehbar, dass auch dieser Ballon sehr hässlich zusammenschnurren wird, piekst man ihn mit genaueren Analysen an. So wird es dann bald einmal heissen: Panama Papers? Pandora Papers? Swiss Leaks? Suisse Secrets? War da mal was?