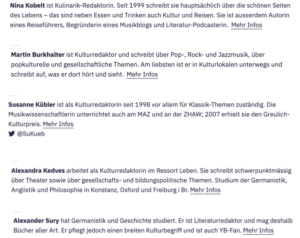Hilfe, mein Papagei onaniert
Die Sonntagspresse. Immer ein Quell der Erbauung.
Wir lassen diesmal den «SonntagsBlick» aussen vor. Auf den ersten Blick hat es keine Stellungsnahme von Walder, Ringier oder Heimgarten drin. Also langweilig.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Auf den zweiten Blick rezykliert der SoBli Dinge, die bereits im «Magazin» von Tamedia erschienen sind, also halten wir uns doch lieber ans Original.
Das ist nun leider nicht wahnsinnig originell, muss man gleich einschränkend sagen. Man kommt doch recht schnell ins Blättern, wenn man sich noch eines der letzten Exemplare der «SonntagsZeitung» im Print erstanden hat. Denn das muss ja nun alles wohl leider eingestellt werden, wenn all die düsteren Ankündigungen eintreffen, was passiert, sollte die Medienmilliarde nicht in den Taschen der Verlegerclans landen.
Drei Seiten Gemurmel über die Ukraine. Blätter. Ein Artikel über die immer noch demonstrierenden «Corona-Massnahmen-Gegner», bei dem das Bild doppelt so viel Platz wie der Text einnimmt und auch viel aussagekräftiger ist.
Ein Artikel über den schwarzen Uni-Professor John McWorther, der gegen die Anti-Rassismus-Bewegung rempelt, sie sei «eine ideologische Schreckensherrschaft». Das beweist, dass es in der Zentralredaktion von Tamedia noch mindestens ein NZZ-Abonnement gibt. Denn dort wurde dieser Professor erst vor Kurzem (und natürlich viel tiefsinniger) porträtiert. Aber was der SoZ-Leser vielleicht nicht weiss, macht ihn nicht heiss.
Und weiss man denn, wie viele Leser der NZZ Alzheimer haben und die gleiche Nachricht beliebig häufig lesen und als neu empfinden können? Dann ein Interview mit einem «Experten für Rassismus und Gewaltverbrechen sowie Leiter des Amts für Justizvollzug und Wiedereingliederung beim Kanton Zürich und Professor für Forensische Psychologie an der Uni Konstanz».
Trotz des ellenlangen Titels sind seine Gedankengänge doch so kurzatmig, dass man sich Sorgen um den Justizvollzug und seine Studenten macht. Denn der Professor zeigt in einem Satz, dass er eigentlich wenig Ahnung von nichts hat: «Prävention ist kein Argument gegen Verbote. Hier macht der Bundesrat einen Überlegungsfehler.» Indem er bekanntlich den Hitlergruss oder Nazisymbole nicht verbieten will.
Den Überlegungsfehler, das Hochhalten der Meinungsfreiheit wie in den USA als implizites Billigen dieser Symbole misszuverstehen, unterläuft aber diesem Jérôme Endrass. Wir haben hier schon versucht, das ganz langsam zu erklären

Bei der NZZaS, nun ja, ist der Blätterreflex nicht weniger ausgeprägt. Rasant schnell ist man auf S. 53, wo Peer Teuwsen damit angibt, dass er einem Bündner Baunersohn nach Island folgen durfte, wo der zum Schriftsteller wurde. Das wär’s dann auch schon fast im Kulturbund, der stolze 6 Seiten umfasst.
Aber, wer sucht, der findet, immerhin gibt es einen halbseitigen Bericht über die abseitige Tatsache, dass Benito Mussolini seit 1937 Ehrendoktor der Uni Lausanne ist. Richtig, bis heute.
Bei Adolf Hitler war es dann in Deutschland (und anderswo) schöner Brauch, dem Jahrhundertverbrecher diese Würde posthum abzuerkennen. Wieso hält denn dann die Uni Lausanne daran fest, den Duce weiterhin als Dr. h.c. zu führen? Mit einer Aberkennung «würde die Sache aus der öffentlichen Debatte verschwinden», wird der Rektor der Uni zitiert. «So einfach dürfen wir es uns nicht machen.»
Die Uni macht’s sich sowieso nicht leicht, «2021 wurden ausschliesslich Frauen mit dem Ehrendoktor der Universität Lausanne geehrt», weiss die NZZaS.
Das lässt den Leser eher ratlos zurück. Den Fehler wieder gutzumachen, dem italienischen Faschisten 1937 den Ehrendoktor verliehen zu haben, würde doch schlicht und einfach bedeuten, dem Diktator den Titel einige Jährchen nach dessen Tod abzuerkennen. Ab so einfach will es sich die Uni nicht machen. Diesem Gedankengang kann man wohl nur folgen, wenn man mindestens zwei Doktortitel hat.
Als weitere Wiedergutmachung und als Abbitte für den Männerüberhang unter Ehrendoktoren wurden nun letzte Jahr nur Doktorinnen geehrt. Dass darin eine negative Diskriminierung enthalten ist (wieso soll es in diesem Jahr plötzlich keinen einzigen auszeichnungswürdigen Mann gegeben haben), fällt weder der Uni, noch dem Autor des Artikels auf.
Also eine nette Trouvaille, gnadenlos versemmelt.

Ach, und in der Wirtschaft wird in der Sonntagspresse ein alter Zopf neu geknüpft. Den Recherchierjournalisten ist nämlich aufgefallen, dass eine Aktie in diesem Jahr an der Schweizer Börse am besten performt hat. Und zwar mit Abstand. Um fast 50 Prozent hat ihr Kurs zugelegt. Das nennt man mal eine Gewinnsträhne für all die, die rechtzeitig drauf gesetzt haben.
Wem gehört nun diese Wunderaktie? Der Credit Suisse? Der UBS? Der ZKB? Scherz beiseite, es ist natürlich unsere Schweizerische Nationalbank. Könnte das etwas damit zu tun haben, dass sie mal wieder nur mit grösster Not die Gelspeicher schliessen kann, so quellen dort Eigenkapital, Gewinne und Bilanzsumme heraus.
Aber nein, wissen die Finanzkoryphäen, «hinter der Kurshausse stecken offenbar wie schon in früheren Fällen deutsche Börsenbriefe, die die Unwissenheit ihres Publikums ausnützen». Wie denn das? «Weil normalerweise weniger als 100 Aktien pro Tag gehandelt werden, kann der Kurs leicht bewegt werden.»
Das ist nun ein Satz zum Abschmecken. Er impliziert, dass der Kurs manipuliert wird. Also auf einem engen Markt mit Kauforders der Preis hinaufgetrieben wird. Das ist nun ein so schwerer Vorwurf, dass er unbedingt mit dem Hauch eines Belegs versehen werden müsste. Aber doch nicht in der SoZ, das würde ja noch zu einer Recherche ausarten.
Interessant ist auch: wenn das so wäre, würde der Aktienkurs unserer SNB hinauf- und vielleicht auch wieder hinunterspekuliert werden. Echt jetzt? Und alle schauen zu? Wieso soll eigentlich die angebliche Unwissenheit des Publikums ausgenützt worden sein? Wenn jemand Anfang Januar investierte, dann hat er locker 50 Prozent Profit gemacht. Ist doch super, so unwissend zu sein.
Und schliesslich: Bei rund 8000 Franken pro Aktie hat die SNB einen Börsenwert von 800 Millionen Franken. Völlig lachhaft, angesichts des Eigenkapitals und ihrer besonderen Funktion. Das Hundertfache wäre eigentlich immer noch ein Schnäppchen. Solchem Fragen nachzugehen, das würde ja zu Denkarbeit ausarten. Aber doch nicht in der SoZ.