Quo vadis, NZZaS?
Journalisten sind intrigant. Aber dumm.
Jonas Projer hatte von Anfang an einen schweren Stand. Von der Konkurrenz wurde er schon vor Amtsantritt niedergeschrieben. Tamedia-Konzernjournalist Andreas Tobler wusste sofort, dass er für das Amt nicht geeignet sei. Die «Republik» veröffentlichte ein dermassen hämisches Porträt, dass sogar die eigene Leserschaft in Kommentaren lautstark gegen so viel niveaulose Polemik protestierte.
Auch intern murmelten viele: Der TV-Mann kann doch gar nicht schreiben. Abgesehen davon, dass auch einige NZZaS-Redaktoren ihre liebe Mühe damit haben: muss ein Chefredaktor auch nicht können.
Dann tropften immer wieder Interna aus dem Redaktionsleben heraus, durchgestochen von intriganten Mitarbeitern. Dieser und jener habe wegen Projer gekündigt, keiner wolle mit ihm wirklich zusammenarbeiten, er habe aus unerfindlichen Gründen Storys gekippt. Wie es wirklich war, konnte Projer natürlich nicht richtigstellen, Redaktionsgeheimnis, Fürsorgepflicht für Untergebene.
Zudem musste er einige Beleidigte massregeln, die sich selbst Chancen auf den Posten ausgerechnet hatten, dazu Querschläger aus der leitenden Etage entsorgen. In diesen Brummton hinein sollte er zudem dafür besorgt sein, den digitalen Auftritt zu verbessern, neue Themengebiete zu erobern.
Eigentlich eine Mission impossible. Bei nüchterner Betrachtung hätte Projer das Angebot wohl ablehnen sollen, es war die Chronik eines angekündigten Todes. Aber bei «Blick»-TV ging es auch nicht richtig voran; das lag nicht an Projer, sondern war halt typisch Ringier. ZACKBUM könnte Namen nennen, müsste dann aber wohl ein Crowdfunding für Prozesskosten machen.
Im Gegensatz zur Redaktion des «Magazin», die bis heute zu feige ist, sich zum Roshani-Skandal zu äussern, soll dann eine Fraktion der NZZaS-Redaktion mit einem Schreiben an den VR der NZZ gelangt sein, in dem sie ihr Unwohlsein über Projer ausdrückte.
Wohlwissend, dass der VR-Präsident, der federführend Projer zur NZZ geholt hatte, nicht mehr im Amt war. Das Ende war absehbar.
Journalisten sind intrigant, beschäftigen sich am liebsten mit sich selbst und finden eigentlich alle anderen – ausser sich selbst natürlich – recht unbeholfen bis unfähig. Neben recherchieren und schreiben gehört zu ihrer Lieblingsbeschäftigung das Meckern und Müllern über andere, vor allem über Vorgesetzte, in erster Linie über den Chef.
Nun haben sie’s nach zwei Jahren Pickeln geschafft: Projer ist weg. Den wenigen Intelligenteren dürfte aber schon beim Schlürfen des ersten Prosecco die klamme Idee den Hals hoch gekrochen sein: und jetzt? Was nun?
Natürlich träumen einige Traumtänzer von der zweiten Chance, nun selbst auf den Chefsessel klettern zu dürfen. Die werden sie vielleicht sogar kriegen, denn ein Quartett zuoberst kann ja keine Dauerlösung sein, sondern nur ein Signal, dass es keiner von denen werden wird.
Woran aber alle, die Projer unbedingt weghaben wollten, nicht dachten: er war die Brandmauer gegen das Mutterhaus. Gegen den Big Boss. Gegen God Almighty. Gegen Eric Gujer. Denn der hatte vor der Installation Projers – Projekt «Seeblick» – einen ernsthaften Anlauf genommen, das kleine gallische Dorf NZZaS völlig seinem Einflussbereich anzugliedern.
Damals stiess er auf Widerstand – und dann auf Projer. Daher war völlig klar: solange Projer auf dem Chefsessel der NZZaS sitzt, bleibt die Redaktion weitgehend autonom (ausser dem Sport, aber was soll’s). Damit wurde die NZZaS zunehmend zum Exoten, nachdem Tamedia und Ringier die ebenfalls zuvor unabhängigen Sonntags-Redaktionen eingemeindet und in den gemeinsamen Newsroom gepfercht hatten.
Das alles wurde wie immer als Synergie und Stärkung und Blabla verkauft, war aber nichts anderes als eine weitere Sparmassnahme. Und genau das blüht nun auch der Redaktion der NZZaS. Womit es dann heissen würde: Schlacht gewonnen, Krieg verloren.
All die Wichtigtuer, Ressortleiter, Autoren, die vor Bedeutung kaum geradeaus laufen können, werden dann zu kleineren Würstchen degradiert, die noch rationierten Senf verteilen dürfen. Keine lustigen Spesenrechnungen mehr, keine wichtigen «bin da an einer grossen Recherche, bitte die nächsten Wochen nicht stören» mehr, keine Lustreisen mehr, kein bayerisches «mir san mir»-Gefühl mehr.
Statt einem neuen Chefredaktor wird es noch einen «Redaktionsleiter» geben, der Mann am Fenster fürs Administrative – wie bei den unzähligen Kopfblättern von CH Media und Tamedia, nur dürfen die dort noch den Namen «Chefredaktor» entwürdigen.
Von Gujer ist bekannt, dass er nicht viel von Kuscheln und Sich-lieb-Haben als Führungsprinzipien hält. Und auch ziemlich klare Vorstellungen hat, wie man die Welt sehen sollte, was wichtige Themen sind – und was vernachlässigt werden kann. Die Pflege von Hobbys und Gärtchen ist ihm auch ein Greuel, sogar ein Gräuel.
Womit nun die kurz triumphierenden Mobber in der NZZaS bereits wie die begossenen Pudel dastehen. Zumindest die intelligenteren, die sich natürlich wie meist in der Minderheit befinden.
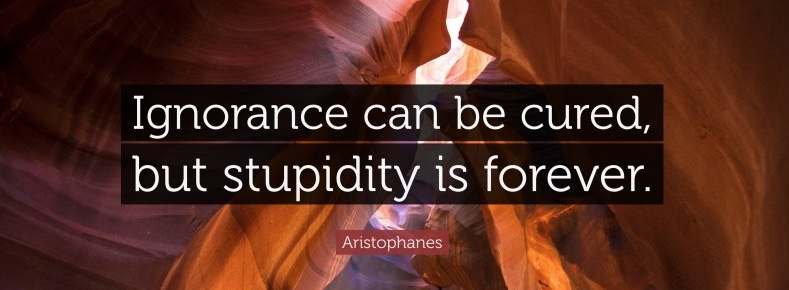









Alle gegen Alle, jeder für sich, aber sau-wichtig: demokratisch!
Journalisten sind auch nur Menschinnen, sie dürfen ihre Ab- und Ausgrenzung einfach im (immer kleiner werdenden) öffentlichen Schaufenster austragen.
Zuerst Treiber, jetzt Vorhoppler der Spaltung und dauer-skandierend: der Bodensatz sind die Andern.
Bis uns UNgewählte den Marsch blasen werden, wo’s lang geht. WHO die nächste Pandemie ausrufen wird und WEF, äh, wann, biz wir kein Geld mehr haben, äh, brauchen.
Was bei den Medien abläuft, parallel jetzt bei den Bahnhofplatzstumpfen ist sinnbildlich für die geplante Zukunft: zuviel Schreiber, zuviel Banker, zuviel Fresser.
Es bliebe die Frage für Alle: wer darf dann noch mitspielen bei ‹mir san mir›?
Zu welchem Preis und ab welcher Preisklasse.
«Journalisten sind intrigant, beschäftigen sich am liebsten mit sich selbst und finden eigentlich alle anderen – ausser sich selbst natürlich – recht unbeholfen bis unfähig. Neben recherchieren und schreiben gehört zu ihrer Lieblingsbeschäftigung das Meckern und Müllern über andere»
Und sowas von Ihnen.