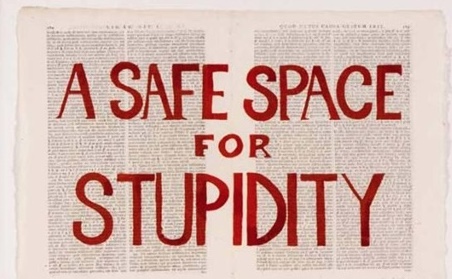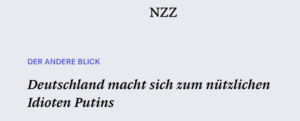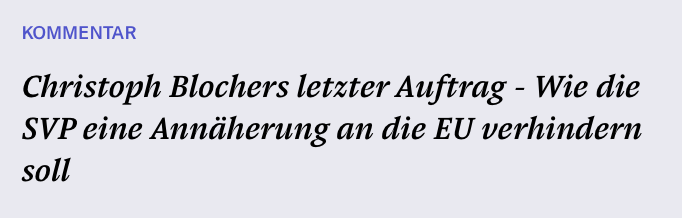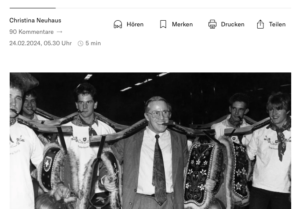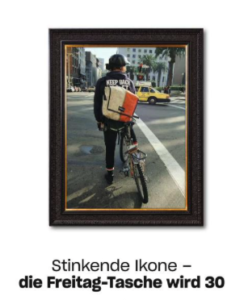Schlichtweg bravo
Dass wir so eine Schlagzeile auf der Front der NZZ noch erleben dürfen …
Wie sich die Zeiten doch ändern. Im Kalten Krieg schrieben in der NZZ die kältesten Krieger gegen die rote Gefahr an. Gegen Fünfte Kolonnen in der Schweiz, gegen alles, was nach Kommunismus roch. Unermüdlich warnten die NZZ-Redakteure, sahen hinter jeder roten Rose eine Verschwörung, die den Bestand der Schweiz bedrohte.
Und jetzt das.
Die NZZ überlässt den angestammten Platz von Eric Gujer dem Wirtschaftsredaktor Gerald Hosp, der verdienstvollerweise ein paar Dinge zurechtrückt.
Zunächst liefert er den heute obligatorischen Obolus ab, wenn man einen Shitstorm dauererregter Gutmenschen vermeiden möchte:
«Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist eine Tragödie. Er bringt menschliches Leid in enormem Ausmass und gewaltige Zerstörungen mit sich. Die wirtschaftliche Grundlage der Ukraine wird ausgehöhlt.
Russland ist der Aggressor, das steht fest. Der russische Staat solle auch für die Schäden zahlen, wird zu Recht gefordert.»
In diesem Sinne hat der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet, das «den Präsidenten dazu ermächtigt, russisches Staatsvermögen in den USA beschlagnahmen zu lassen.»
Wunderbar, endlich, da jubiliert Volkes Stimme. Recht geschieht’s dem Putin-Regime, genau, reich, Russe, das reicht schliesslich auch für Beschlagnahme von Vermögenswerten. Super, dass das in den USA nun auch endlich auf russisches Staatsvermögen angewendet wird. Da müssen dann die europäischen Marionetten, Pardon, die EU-Länder schleunigst nachziehen, und wo bleibt die Schweiz?
Aber was schreibt Hosp denn da?
«Wenn die Gelder direkt eingestrichen würden, würde dies die in den Entwicklungs- und Schwellenländern weitverbreitete Ansicht verstärken, dass sich der Westen nur um das Völkerrecht schert, wenn es ihm gerade passt. Der Vorwurf der Heuchelei und des Diebstahls wäre schnell bei der Hand, zumal die USA und die EU-Staaten nicht direkt mit Russland im Krieg sind. Eine Enteignung der russischen Gelder ist deshalb ein Fehler. Was wäre der Unterschied zum Vorgehen Russlands, ukrainische Weizenfelder zu plündern?»
Aber was denn, hat nicht auch der Europarat beschlossen, dass einem «Kompensationsmechanismus» konfiszierte Gelder russischer Privatpersonen, Unternehmen und des russischen Staates zur Verwertung übertragen werden sollen?
Auch da setzt Hosp ein Fragezeichen: «Gleichzeitig gilt es laut Europarat, «die Prinzipien des Völkerrechts aufrechtzuerhalten und die privaten Eigentumsrechte zu respektieren». Das ist der springende Punkt. Es ist mehr als nur zweifelhaft, dass dies erfüllt werden kann.»
Dann weist er auf etwas hin, was im Furor schnell vergessen geht:
«Laut dem Völkerrecht gilt prinzipiell Immunitätsschutz: Staaten können nicht einfach auf das Vermögen eines anderen Landes zurückgreifen, was Verlässlichkeit auf internationaler Ebene bringt.»
Und dann zieht er nochmals die feine rote Linie, wo rechtlich noch knapp Haltbares in Illegales umschlägt: «Der Westen reagierte auf die russische Invasion mit einer Blockade von Notenbankgeldern, was zwar auch ungewöhnlich war, aber diesen Vorgaben entspricht. Eine Konfiskation und Weiterverwendung würde aber bedeuten, dass die Massnahme nicht mehr umkehrbar ist, das Geld wäre weg.»
Was bedeutet nun die Entscheidung der USA? «Dadurch wird die Einsicht genährt, dass auf internationaler Bühne das Recht des Stärkeren noch mehr zunimmt als ohnehin schon.
Nun gibt es aber das Problem, dass nur rund zwei Prozent der weltweit gesperrten russischen Staatsgelder in den USA liegen. Rund 200 Milliarden liegen in der EU, «genauer gesagt: bei der zentralen Verwahrungsstelle Euroclear in Belgien».
Und hierzulande?
«Für die Schweiz sind aber aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit und des Eigentumsschutzes weder Konfiskationen wie in den USA noch die Verwertung der Erträge wie in der EU ein gangbarer und wünschenswerter Weg. »
Und dann weist die NZZ noch auf einen Präzedenzfall aus dem Jahr 2021 hin: «Die USA konfiszierten nach dem chaotischen Rückzug aus Afghanistan die Währungsreserven der Zentralbank des Landes, was wenig Beachtung fand.»
Man muss diesen Kommentar so ausführlich zitieren, weil er so erfrischend ist wie eine Oase in der Wüste der alle Prinzipien eines Rechtsstaats vergessenden Krakeeler, die Konfiszieren der beschlagnahmten Gelder und ihre Verwertung für die Ukraine fordern. Ohne zu merken, dass sie damit etwas Fatales tun.
Ein Rechtsstaat kann sich mit allem Recht gegen unrechte Handlungen zur Wehr setzen. Dazu ist er legitimiert. Verwendet er aber selbst rechtsstaatlich fragwürdige Methoden – nach der Devise «der gute Zweck heiligt auch böse Mittel » – dann begibt er sich auf eine ganz schiefe Bahn, an deren Ende er sich selbst mehr schadet als demjenigen, der Unrecht tut.
Zu dieser einfachen Erkenntnis sind immer weniger Kommentatoren in der Lage.