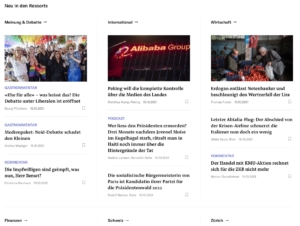Messerscharfer Blick
Eric Gujer schneidet sich eine Scheibe Deutschland ab.
Der vorletzte CEO der NZZ scheiterte in Österreich. Die Verabschiedung von Veit Dengler war entsprechend kühl: «Verwaltungsrat und CEO der NZZ-Mediengruppe sind zum Schluss gelangt, die Führung des Unternehmens in neue Hände zu legen.»
NZZ.at war ein schmerzhafter Flop, denn die NZZ ist dafür bekannt, selbst in höchster Not ein einmal gestartetes Projekt nicht einfach aufzugeben. Der Österreicher Dengler meinte, nicht nur der von ihm mitbegründeten Partei Neos Schub zu geben, sondern auch eine erfolgreiche Expansion der NZZ lancieren zu können.
Nach seinem Abgang im Jahre 2017 wurde Dengler COO der Bauer Media Group. Abgang dort 2021.
Inzwischen ist der CEO der NZZ wieder der Mann im Hintergrund, und wie zu Zeiten, als es diesen Posten noch gar nicht gab, dominiert der Chefredaktor. Auch der Vorgänger von Eric Gujer agierte nicht gerade erfolgreich. Markus Spillmann war der erste Chefredaktor des Blatts, der seinen Posten nicht freiwillig aufgab.
Seit 2015 sitzt nun Gujer fest im Sattel, als Chef und als Geschäftsführer. Er hat sich die unnahbare Autorität zurückerobert, die noch Hugo Bütler in seinen 21 Jahren auf der Kommandobrücke ausstrahlte. Bütler, über dessen Kürzel bü. sich Niklaus Meienberg selig lustig machte, dass das nicht für Büttel, sondern für Bürgertum stehe, war tatsächlich das Sprachrohr des Bürgertums, für ihn zweifelsfrei in der FDP verortet.
Die Zeiten sind komplizierter geworden, aber da steht Gujer drüber. Er ist so allmächtig, dass selbst die Tätigkeit seiner Frau als NZZ-Redaktorin kein sichtbares Naserümpfen auslöst. Schliesslich schreibt sie als Claudia Schwartz, und natürlich werden ihre Beiträge nicht anders als alle anderen behandelt.
Allerdings kann es dann schon vorkommen, dass einen widerborstigen Mitarbeiter ein strafender Blitz von God Almighty trifft.
Aber neben solchen kleinen menschlichen Schwächen betreibt Gujer eine erfolgreiche Expansion nach Deutschland. Was ja auch logisch ist, 80 Millionen Einwohner statt 8 wie in Österreich. Zudem schwächelt dort das Sprachrohr des Bürgertums FAZ; der deutsche «Tages-Anzeiger» namens «Süddeutsche Zeitung» trieft vor Gesinnungsjournalismus, und die «Welt» konnte sich nie als richtiges Sprachrohr des Bürgertums etablieren. Dann gibt es noch «Die Zeit», aber die schwebt weitgehend über den Dingen.
Gujer erfreut nun regelmässig Deutschland mit seiner Kolumne «Der andere Blick». Sozusagen das Wort zum Wochenende, das früher auf der Front der Samstags-Ausgabe der NZZ stattfand.
Hier ist’s nach Deutschland gerichtet, elegant und schneidend geschrieben. Aktuell gerade:
«Deutschland, Messerland: Wieder müssen Unschuldige wegen einer verantwortungslosen Migrationspolitik sterben».
Das traut sich eigentlich sonst niemand in Deutschland ausserhalb der AfD. Wenn schon, denn schon, sagt sich Gujer und haut weiter drauf: «Schweigen und Ratlosigkeit sind die Antwort der Bundesregierung auf die Verbrechen.»
Dann zeigt Gujer, was man mit messerscharfer Logik (okay, damit ist der Kalauer erschöpft) argumentativ herausholen kann, in aller Schönheit:
«So weist die «Süddeutsche Zeitung» darauf hin, dass auch Deutsche andere Menschen erstechen. Und sie hält fest: «Das öffentliche Interesse ist bei Straftaten von Geflüchteten oft ungleich grösser als bei Delikten von Deutschen.» Nur die Taten der Ausländer würden in Talkshows erörtert.
Das aber deutet nicht auf Fremdenfeindlichkeit hin, sondern ist völlig natürlich. Messergewalt von Deutschen lässt sich nicht abwenden; Deutsche können nicht aus Deutschland ausgesperrt werden. Tödliche Attacken von Flüchtlingen sind jedoch kein Schicksal. Sie sind die Nebenfolge einer willentlichen Politik. Mit dem Schicksal kann man nicht streiten. Politik hingegen kann man diskutieren und verändern.»
Natürlich hat Gujer sowohl konkrete wie abstrakte Ratschläge zur Hand: «Hinschauen und Verantwortung übernehmen statt ignorieren und beschönigen. Das wäre ein guter Vorsatz für eine bessere Flüchtlingspolitik.»
Damit – und mit einer stetig ausgebauten Deutschland-Redaktion in Berlin – setzt Gujer das Alleinstellungsmerkmal der NZZ um. Sie setzt nicht auf Verkaufsplattformen wie das Haus Tamedia, nicht auf Digitalisierung und Wertschöpfungsketten wie Ringier, nicht auf Multichannel wie CH Media, sondern auf Content.
Natürlich wird Gujer deswegen von der Konkurrenz in der Schweiz immer wieder angerempelt. Tamedia, WoZ und «Republik» überbieten sich darin, der NZZ im Allgemeinen und Gujer im Speziellen vorzuwerfen, die wilderten im rechtskonservativen Lager und hätten keine Angst vor mangelnder Abgrenzung von der AfD.
Das lässt Gujer aber zu Recht kalt, weil die NZZ – im Gegensatz zu Tamedia – beispielsweise in der Frage der Waffenlieferung an die Ukraine ein strammer Verteidiger der Rechtsstaatlichkeit ist. Zudem merkte Gujer mal maliziös an, bezüglich journalistische Qualität sei es doch so, dass der Tagi immer mehr Content von der Süddeutschen aus Deutschland übernehme und seinen Schweizer Lesern serviere, dabei das eigene Korrespondentennetz zerreisse. Während die NZZ ihre Mannschaft in Deutschland stetig verstärkt.
Gujer ist gut vernetzt und hat einen gewissen Hang, sich nachrichtendienstliche Erkenntnisse zu eigen zu machen. Als Auslandkorrespondent unter anderem in der DDR, in Russland und in Israel gewann er deutliche rechtskonservative Erkenntnisse.
Sein grosser Vorteil ist aber zweifellos, dass die NZZ immer mehr ein Leuchtturm wird, weil die Konkurrenz ihr Heil im Skelettieren und Zu-Tode-Sparen der Redaktionen sieht. Auch wenn die NZZ ihr Korrespondentennetz lockerer geknüpft hat als auch schon, enthält meistens jede Tagesausgabe mehr Denkstoff als eine Wochenladung der Konkurrenz, wo dünn analysierte News und geistig bescheidene Meinungen immer mehr um sich greifen.
Natürlich kann und muss man auch die NZZ kritisieren. Aber mit Vorsicht, denn wenn auch dieses Blatt noch flach wird, dann wird es langsam echt schwierig, sich im deutschen Sprachraum qualitativ hochstehend zu informieren.
Packungsbeilage: Autor René Zeyer war einige Jahre Auslandkorrespondent der NZZ und publizierte früher regelmässig dort, als es noch eine Medienseite gab.