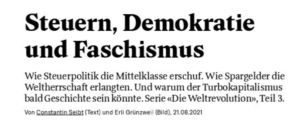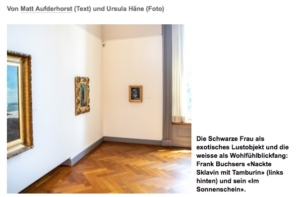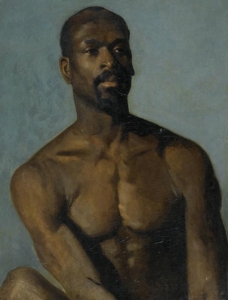Die Wochenzeitung WoZ zählt vor der Abstimmung über die e-ID messerscharf eins und eins zusammen.
Am 7. März findet sie statt, die Volksabstimmung über die elektronische Identität im Internet. Für die Befürworter ist klar: Damit werden die rechtlichen Grundlagen geschaffen für eine staatlich anerkannte Schweizer e-ID (elektronische Identität). Es sei höchste Zeit, denn immer mehr Menschen, Behörden, Verbände und Unternehmen seien online und bräuchten eine zweifelsfreie Identifikation im Internet. Die Gegner hingegen wittern Gefahren: Private Unternehmen sollen in Zukunft den digitalen Schweizer Pass ausstellen und sensible private Daten verwalten. An die Stelle des staatlichen Passbüros würden Grossbanken, Versicherungsgesellschaften und staatsnahe Konzerne treten.
Logisch, dass private Unternehmen am Lobbieren sind für ein JA. Denn es winkt die grosse Kasse. Kaspar Surber hat dazu in der WoZ eine Recherche-Story veröffentlich. Sie handelt von Ringier. «Folgt man seiner Datenspur, sieht man schnell, über welch gigantische kommerzielle Interessen am 7. März abgestimmt wird. Und welche Gefahren drohen», schreibt Surber.
Ringier Treiber hinter Digitalswitzerland
Eine zentrale Rolle in seinem Text nimmt Ringier-CEO Marc Walder ein. Kein Wunder, war Walder schon 2015 treibende Kraft bei der Gründung von Digitalswitzerland mit der Post, den SBB, Swisscom, Migros, Ernst & Young, UBS, Google, der ETH und natürlich Ringier. Heute zählt der Verband mehr als 150 Mitglieder.
Bei der Abstimmung gehe es durchaus darum, ob der Staat oder Private die e-ID ausstellen und auch, ob die sensiblen Daten zentral in privaten Rechnern oder dezentral (etwa auf dem eigenen Handy) gespeichert werden.
Es geht um nicht weniger als die völlige Kommerzialisierung personenbezogener Daten.
Etwas, was jetzt in der Stossrichtung schon nach dem (freiwilligen) Login bei privaten Medienhäusern passiert.
Für die WoZ ist das Verschwimmen der Daten eine Gefahr, ein Abbau der Demokratie. Ebenfalls klar: Doris Leuthard, damals Bundesrätin, gab Marc Walder in einem Telefongespräch den entscheidenden Tipp. Digitalswitzerland sei wichtig, «doch vergessen Sie die Bevölkerung nicht». Der O-Ton ist nachzulesen in den Ringiermedien. Fazit: WoZ-Autor Kaspar Surber hat seine Hausaufgaben gemacht und die irritierende Vertrautheit ausgegraben «Die Ringier-Medien haben mit seitenlanger Begeisterung dokumentiert, was ihr CEO alles für die Digitalisierung des Landes tat».
Am Digitaltag fand die Initialzündung statt
Daraufhin liess Walder 2017 den «Digitaltag» organisieren. Die CVP-Bundesrätin reiste als «Mutter des Digitaltags» («Blick») in einem – naja – ganz herkömmlichen Zug nach Zürich und eröffnete im Hauptbahnhof den Event: «Wir zünden hier die Digitalrakete Schweiz», zitiert die WoZ den Blick. Dabei war für das Blatt von der Stadtzürcher Hardturmstrasse klar: Das Ziel bestand in der privatisierten, kommerzialisierbaren e-ID.
«Cash», das Wirtschaftsportal von Ringier, berichtete über die damalige Medienkonferenz: «Es ist ein gewaltiger Durchbruch» (SBB-Chef Andreas Meyer). «Natürlich hoffen wir, dass die Politik uns den notwendigen gesetzlichen Rahmen gibt» (Lukas Gähwiler, VR-Präsident der UBS Schweiz).
Dann wurde laut WoZ nur wenige Monate später die Botschaft zum Gesetz über die elektronischen Identifizierungsdienste vom Bundesrat verabschiedet.
Ziel: Die e-ID solle es dem User erlauben, sich im digitalen Raum einfach und klar auszuweisen, vergleichbar mit einer Identitätskarte. Ein klassisches Beispiel für eine Anwendung ist die Bestellung eines Betreibungsregisterauszugs für die Wohnungssuche. Weitere Anwendungsbeispiele sind das Gesundheitswesen und das Shoppen.
Eigentlich stand immer fest. Wie bei der Sicherheit mit dem Militär und grossmehrheitlich hat der Staat das Monopol.
So war vorgesehen, dass das Schweizer Justiz- und Polizeidepartement die e-ID herausgibt, wie die ID und den Pass. Doch dann kam es laut WoZ zur Kehrtwende: «Obwohl Staaten wie Deutschland dieses Modell anwenden, setzte der Bund aus Angst vor dem technologischen Wandel und drohenden Kosten auf Auslagerung an Private. Der Staat behält so zwar die Aufgabe, eine Person bei der Ausgabe einer e-ID zu überprüfen – der Verkauf, der Vertrieb sowie die Verwaltung der elektronischen Identität werden hingegen an sogenannte Identity Provider (IdP) vergeben», schreibt Surber.
Die Folge: Am nächsten Digitaltag 2018 brachte sich dann auch schon das Swiss-Sign-Konsortium als künftiger Provider in Stellung. Es startete eine Kampagne für seine Swiss-ID, die fürs Erste ein Log-in für verschiedene Onlinedienste war. In einem Werbefilm machte sogar Doris Leuthard Stimmung für das Anliegen. Das geplante Gesetz zur e-ID war damals noch nicht einmal im Parlament diskutiert worden.
Und Ringier? Laut der WoZ ist Ringier zwar nicht Mitglied des Swiss-Sign-Konsortiums. Mit der Swiss ID könne man sich aktuell aber auch in die Angebote des Medienhauses einloggen. Dazu gehören etwa Autoscout, Immoscout, Dein Deal, Jobcloud, Geschenkidee und Ticketcorner. Welche Rolle nun schreibt sich Marc Walder bei der Entstehung der e-ID zu? Mit der WoZ wollte er nicht sprechen, immerhin gab er aber schriftlich Antworten. Dabei beschreibt die WoZ Walder recht launisch: «Walder war erst Tennisprofi, wurde dann Journalist, stieg zum Chefredaktor der «Schweizer Illustrierten» und des «SonntagsBlicks» auf, hatte an einem Managementkurs in Harvard ein digitales Erweckungserlebnis, krempelte darauf den Ringier-Konzern als CEO um und wurde von Besitzerfamilie Ringier als ultimativer Vertrauensbeweis zum Miteigentümer gemacht. Leider fand Walder, der mit seinem Glatzkopf auf Fotos stets ein bisschen wie ein Guru wirkt, der freundlich-nachdenklich in die Zukunft blickt, keine Zeit für ein Interview». Ende Zitat.
Walder gibt der WoZ Auskunft – nicht mündlich, aber schriftlich
Walder schreibt der WoZ «bescheiden» zurück, bezeichnet sich selbst ganz einfach als «Befürworter der e-ID»: «Ausländische Erfahrungen zeigen, dass eine erfolgreiche Digitalisierung auf einer erfolgreichen e-ID beruht.» Ob Ringier auch ein Geschäftsinteresse verfolge, will er nicht konkret beantworten: «Eine vertrauenswürdige e-ID ist die Basis für eine digitale Schweiz.» Er bringt dazu die globalen Player wie Google und Amazon ins Spiel. Ohne Bündelung der Kräfte habe man «nicht den Hauch einer Chance», ist Walder überzeugt.
Bei den Log-ins setzt Ringier momentan auf ein eigenes System mit dem Namen Ringier Connect und weitere Dienste wie die Swiss ID. Es ist aber vieles noch freiwillig. Blick-online-Inhalte wie auch Blick-TV kann man auch nutzen, wenn man bei der Frage nach dem Login «lieber nicht» anklickt.
Die WoZ hat für die Gegenmeinung Erik Schönenberger, Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft, befragt. Er sagt:
«Die Medienkonzerne sehen bei der Einführung der E-ID einen Goldschatz für ihre personalisierte Werbung funkeln.»
Denn sie hätten einen klaren Vorteil: Im Gegensatz zu Cookies, die nur Geräte wie den Laptop tracken, oder zu Log-ins, bei denen man sich auch als Klaas Klever anmelden kann, werde die x-ID in der vorliegenden Form eine eindeutige Identifikation der User ermöglichen, schreibt die WoZ.
Und das Argument, dass man beim online-Einkauf Vorteile habe mit der E-ID? «Warum soll ich mich beim Einkaufen überhaupt ausweisen müssen», fragt Schönenberger. In der vorliegenden Form diene die E-ID primär der Kommerzialisierung.
Greift Ringier nun in den Abstimmungskampf ein?
Kaspar Surber von der WoZ bringt ein aktuelles Beispiel der versuchten Politbeeinflussung. Demnach ist für ihn das Konstrukt auch aus demokratiepolitischer Sicht heikel. Kürzlich tauchten auf den Plattformen «Blick», «Beobachter» oder «Schweizer Illustrierte» plötzlich Beiträge mit dem Titel «Darum brauchen wir eine elektronische Identität» auf. Präsentiert werden die Publireportagen von Digitalswitzerland. Gestaltet hat sie die Agentur Furrerhugi. Die Firma mit gut 60 Mitarbeitenden hat den Hauptsitz in Bern. Ableger gibt’s etwa in Bern, Lausanne und Brüssel. Bekannte Köpfe sind Claudine Esseiva, ehemals FDP-Generalsekretärin und der frühere Journalist Martin Stoll.
Gegenüber der WoZ spricht Daniel Graf, der mit der Onlinesammelplattform WeCollect das Referendum gegen die E-ID initiiert hat, von einem «Dammbruch». «Ringier macht auf den eigenen Newsplattformen Schleichwerbung für ein Anliegen, mit dem es kommerzielle Interessen verfolgt: Wie soll da noch ein unabhängiger Journalismus möglich sein?» Die Entwicklung stelle eine Bedrohung für die Demokratie dar: «Die E-ID wird es ermöglichen, gezielt Werbung an Wählersegmente auszuspielen. Der Kaufkräftige gewinnt noch mehr Macht in Abstimmungskämpfen.» Das Referendumskomitee hat beim Presserat eine Beschwerde gegen Ringier eingereicht, 1800 Bürgerinnen und Bürger unterstützen sie online.
Für Marc Walder (55) ist das alles kein Problem. «Werbevermarktung und redaktionelle Berichterstattung sind zwei verschiedene Paar Schuhe», schreibt er der Wochenzeitung. «Unsere Medien werden in der Berichterstattung sowohl die Befürworter als auch die Gegner zu Wort kommen lassen.»
Der Abstimmungstermin ist in fünf Wochen.
In einer ersten Version stand wirkt statt winkt. Danke dem Leser für den Hinweis.