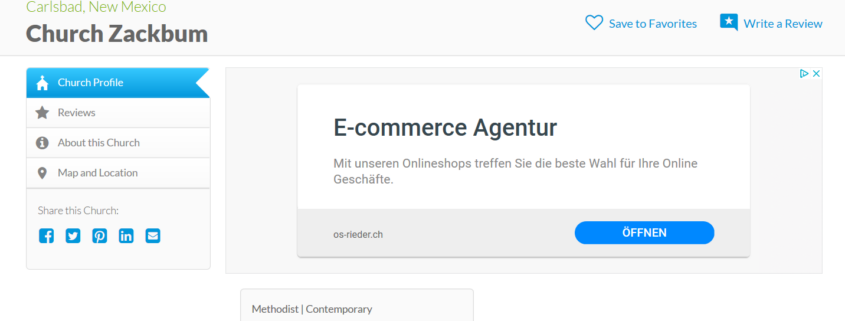«Schnallt eure Gürtel enger und zieht euch warm an!»
In Europa kommt die «Moral vor dem Fressen», in Asien ist es genau umgekehrt. Teil 2
Von Felix Abt
Hier geht’s zu Teil 1.
Journalisten, aber auch Politiker, die im Rampenlicht der Medien stehen wollen, lassen heutzutage kaum eine Gelegenheit für ein regelrechtes China-Bashing aus, vom angeblich grausamen Schicksal eines chinesischen Tennisstars über den erfundenen Völkermord in Chinas Xinjiang bis hin zu Taiwan, das angeblich von China militärisch besetzt werden soll, obwohl dies überhaupt keinen Sinn macht, da die Chip-basierte Wirtschaft und das tägliche Leben der Welt (einschließlich Chinas) völlig zum Erliegen kämen. Im Interesse der amerikanischen Politik, sowohl China als auch Russland zu schwächen, fordern sie jedoch die Isolierung als vorsorgliche Bestrafung Chinas.

Kein Interesse an den von Washington provozierten Spannungen mit Beijing zu Lasten von Taiwan: Taiwans Oppositionspartei, die Kuomintang, möchte jedenfalls dazu beitragen, sie zu verringern.

Eine Isolierung Chinas, wie sie westliche Politiker und Journalisten fordern, geht selbst eingefleischten Sezessionisten in Taiwan zu weit, da die Insel viel mehr Handel mit China als mit den Vereinigten Staaten betreibt.
Und trotz erheblicher Meinungsverschiedenheiten zwischen Vietnam und China, insbesondere über die Grenzziehung im Südchinesischen Meer, das die Vietnamesen als Ostmeer bezeichnen, möchte Vietnam den Handel mit China eher ausweiten als einschränken, um das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand der eigenen Bevölkerung zu steigern.

Vietnamesische Medien berichten, dass Vietnam und China «ihre Beziehungen in allen Bereichen ausbauen» wollen. Die offizielle Vietnam News Agency schrieb am 13.7.2022: «Vietnam ist Chinas grösster Handelspartner in der ASEAN und der sechstgrösste Handelspartner in der Welt. China bleibt der grösste Handelspartner Vietnams.»
Als US-Vizepräsidentin Kamala Harris im August 2021 Singapur und Vietnam besuchte und diese beiden Länder dazu bewegen wollte, sich mit Amerika gegen China zu verbünden, stieß sie auf wenig Gegenliebe. Denn diese südostasiatischen Staaten wollen gute Beziehungen zu allen Ländern pflegen und nicht wie die europäischen Länder als nützliche Idioten des amerikanischen Imperiums und zu ihrem eigenen Schaden missbraucht werden. Kurz vor ihrer Ankunft in Hanoi traf der vietnamesische Premierminister mit dem chinesischen Botschafter zusammen, um China zu versichern, dass sich sein Land aus allen Grossmachtrivalitäten heraushalten werde.
Der «Spiegel» und die vielen gleichgesinnten europäischen Medien thematisieren das natürlich nicht. Wie im Falle des Ukraine-Konflikts werden auch im Falle Chinas die Vorgeschichte und die Hintergründe systematisch ausgeblendet und diejenigen, die es wagen, Licht ins Dunkel zu bringen, von ihnen diffamiert. Dies wiederholt sich nun im neuen, von den USA heraufbeschworenen Konflikt mit China um Taiwan, wo wieder entscheidende Fakten zensiert werden:
Dazu gehört zum Beispiel die Tatsache, dass China die Insel Formosa/Taiwan, die 1682 von der von Mandschuren gegründeten Qing-Dynastie unter die Kontrolle des Festlandes gebracht wurde, mit viel mehr Respekt behandelt als die rabiaten USA Kuba.
China treibt regen Handel mit Taiwan, und Taiwanesen betreiben zahlreiche Fabriken auf dem chinesischen Festland. Im Gegensatz dazu haben die USA jahrzehntelang einen brutalen Wirtschaftsboykott gegen Kuba verhängt, den Washington auch anderen Ländern auf der ganzen Welt aufgenötigt hat. Nicht einmal Hilfsgelder dürfen nach Kuba überwiesen werden, was im Fall von Taiwan jederzeit möglich ist. Während Taiwan zu China gehört, war Kuba nie eine «Provinz» oder ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten, abgesehen von der Periode, in welcher das Territorium dieser Insel de facto unter der Kontrolle der amerikanischen Mafia stand, die es als Riesenbordell missbrauchte bis zur Revolution unter Fidel Castro.
Jetzt rüstet Amerika Taiwan massiv auf. Stellen Sie sich vor, China würde Kuba auf die gleiche Weise aufrüsten: Die Amerikaner würden den Chinesen aufgrund ihrer Monroe-Doktrin sofort den Krieg erklären. Und chinesische Flugzeugträger, die ständig zwischen Florida und Kuba kreuzen würden, wie die US-Marine in der Nähe von Taiwan und dem chinesischen Festland, würden von den USA wahrscheinlich ohne zu zögern versenkt werden.

Russland umzingeln? Das ist bereits geschehen, einschließlich fünf Runden der NATO-Osterweiterung. Jetzt geht es darum, China zu umstellen und, wenn möglich, einen neuen lukrativen Krieg für Amerikas grössten und einflussreichsten Industriezweig, die Kriegsindustrie, zu provozieren. Die nächste «kubanische Raketenkrise» bahnt sich bereits an, diesmal aber schnell und grob: Die USA wollen 27,4 Milliarden Dollar ausgeben, um China entlang der «ersten Inselkette», einschließlich Taiwan, mit Raketen einzukreisen.
«Die Schweiz anerkannte die Volksrepublik China am 17. Januar 1950. Seither verfolgt sie eine Ein-China-Politik und betrachtet die Republik China, wie die Behörden von Taiwan (Chinesisches Taipei) sich selbst bezeichnen, nicht als eigenständigen Staat, sondern als Teilstaat Chinas. Bei ihren bilateralen Beziehungen und auf internationaler Ebene anerkennt die Schweiz nur die Volksrepublik China mit Regierungssitz in Peking.»
Dass die oben genannten Zusammenhänge in den Medien verschwiegen werden, ist nicht neu. Auch im Ukraine-Konflikt wurde z.B. nicht darauf hingewiesen, dass die USA seit Jahrzehnten die Strategie verfolgen, einen funktionierenden Wirtschaftsraum Russland-EU zu verhindern. Sie erwähnten nicht die bekannten US-Strategiepapiere zur Destabilisierung Russlands. Oder die erklärte Absicht der USA, ihre Rolle als «Weltordnungsmacht» um jeden Preis aufrechtzuerhalten und den Dollar als Weltwährung zu sichern, den sie als Waffe gegen Länder einsetzen, die sich dem Willen des eigennützigen Imperiums widersetzen. Und die Interessen und der enorme Einfluss der gigantischen westlichen Rüstungsindustrien und ihrer Aktienbesitzer wurden auch nicht analysiert und hinterfragt.
Stattdessen haben sie es vorgezogen, die Kriegspropaganda der einen Seite (Russland) im Ukraine-Konflikt zu geißelnund die der anderen Seite (Kiew) unkritisch zu übernehmen und zu verbreiten, selbst den widerlegten Vorwurf, dass russische Soldaten ukrainische Babys vergewaltigen oder dass russische Truppen zivile Gebäude beschießen, ohne zu erwähnen, dass die Ukraine dort systematisch Zivilisten als menschliche «Schutzschilde» missbraucht.

Nicht der Rede wert ist auch die Tatsache, dass China hundert Jahre lang von ausländischen Mächten auf ungeheuerliche Weise gedemütigt wurde, gekennzeichnet durch Pandemien, Hungersnöte, Korruption, Massenmord und weit verbreitete Drogenabhängigkeit. Die Opiumkriege gegen China halfen den Briten, ihre Handelsbilanz zu verbessern, indem sie Opium aus ihrer indischen Kolonie bezogen und es mit grossem Gewinn in China verkauften. Die Folge war, dass Ende des 19. Jahrhunderts etwa 10 % der chinesischen Bevölkerung opiumsüchtig war, und ein erheblicher Teil des Silbers und anderer Vermögenswerte des Landes außer Landes floss, um das Opium zu bezahlen. Viele der wirtschaftlichen Probleme, mit denen China später konfrontiert war, wurden entweder direkt oder indirekt auf den Opiumhandel zurückgeführt.
Fortsetzung und Schluss folgt.






 a
a