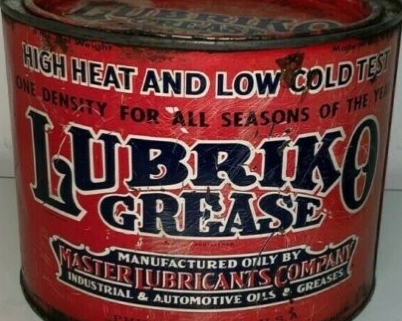Was weg ist, fehlt nicht. Oder doch?
Wer erinnert sich noch an die grossen Debatten, ob eine Impfung gegen Corona nützt oder schädlich ist? Ob Ungeimpfte potenzielle Massenmörder seien? Da liefen Corona-Kreischen wie Marc Brupbacher zu Höchstformen auf, sahen völlige Verantwortungslosigkeit herrschen («Der Bundesrat ist völlig übergeschnappt») und das Ende der Welt nahen.
Vorher völlig unbeachtete Wissenschaftler überboten sich in Ankündigungen von Todeszahlen (Wissenschaftler Althaus gewann mit dem Höchstgebot von 100’000 Toten in der Schweiz). Eine Task Force ermächtigte sich, verantwortungsfrei allen Politikern, inklusive Bundesrat, der sie eigentlich zwecks stillen Beratungsdienstleistungen ins Leben gerufen hatte, Noten, Ratschläge und besserwisserische Forderungen zukommen zu lassen.
Das Maskentragen war nicht nur obligatorisch, sondern Nicht-Träger wurden öffentlich an den Pranger gestellt; alle Dissidenten von der medial unterstützten Regierungslinie wurden als Corona-Leugner, Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker und willige Gefolgsleute von üblen Rechtspopulisten beschimpft. Wer an bewilligten Demonstrationen teilnahm, war ein nützlicher Idiot, wer sie mit Treicheln begleitete und den eidgenössischen Schlachtruf «Horus» anstimmte, ein Faschist.
Welche Schäden die hysterische und überzogene Politik wirtschaftlich und gesellschaftlich angerichtet hat – Schwamm drüber.
Vorbei, verweht, vergessen.
«#metoo», die grosse Bewegung gegen männliche Herrschaft, Übergriffe von Mächtigen auf Abhängige, der Aufschrei lange schweigender Frauen. Neben wenigen sinnvollen Anklagen produzierte die Bewegung eine Hexenjagd, diesmal aber auf Männer. Harvey Weinstein, als Sexmonster entlarvt und in den Knast gesteckt. Kevin Spacey und so viele andere: falsch beschuldigt, ruiniert, fertiggemacht, und wenn sie Jahre später von allen Anwürfen freigesprochen werden, interessiert das niemanden mehr wirklich. Die doppelte Endmoräne dieser Bewegung trägt die Namen Anuschka Roshani und Till Lindemann. Sie als Falschbeschuldigerin, er als Falschbeschuldigter.
Erinnert sich noch jemand daran, dass der heruntergekommene «Spiegel» dem Rammstein-Sänger sogar eine Titelgeschichte widmete, Roshani ihre grösstenteils frei erfundenen und längst widerlegten Anschuldigungen dort veröffentlichen durfte? Dass nun auch noch ein gefallener linker Starreporter seine Karriere beenden musste, weil ihm anonym verbale Übergriffe und ein angeblicher körperlicher Übergriff vorgeworfen werden, wobei eine medienbewusste Medienanwältin eine zwielichtige Rolle spielt: war da mal was?
Vorbei, verweht, vergessen.
«We stand with Ukraine», jede bessere WG machte neben der Pace-Fahne Platz für eine Ukraine-Flagge. Der ehemalige Schauspieler Volodymyr Selenskyj, an die Macht bekommt dank der Millionen eines ukrainischen Oligarchen, der sich damit eine Amnestie von gewaltigen Unterschlagungen erkaufte, wurde zum neuen Superhelden des Widerstands. Selbst eine Modestrecke in der «Vogue» mitsamt vor zerschossenen Flugzeugen posierender Gattin konnte diesem Image keinen Abbruch tun. Endlich war die Welt wieder in Ordnung. Nach dem bösen chinesischen Virus nun der böse russische Autokrat.
Seither dürfen Ukrainer und Russen in einem Stellvertreterkrieg verbluten. Der völkerrechtswidrige Überfall hat bislang Schäden in der geschätzten Höhe von 1000 Milliarden US-Dollar angerichtet. Zahlen wird die nicht Russland, auch nicht die Ukraine. Und erst recht nicht China oder Indien. Wer bleibt? Genau, in erster Linie die EU. Da gab es neulich eine gross angekündigte ukrainische Offensive. Wie geht’s der, wo steckt sie, ist sie erfolgreich, erfolglos, ist die Ukraine am Ende oder Russland oder beide? Wen interessiert’s im Moment, der arme Selenskyj versucht verzweifelt, darauf aufmerksam zu machen, dass es Hamas-Terrorismus und russischen gäbe. Dabei zählen seine westlichen Verbündeten ihre Munitions- und Waffenlager durch und fragen sich, womit sie allenfalls Israel unterstützen wollen.
Vorbei, verweht, vergessen.
Ein Treppenwitz ist dagegen, dass der grosse Shootingstar der Schweizer Literatur, der mehrfach preisgekrönte Kim spurlos verschwunden ist. Das eint ihn mit dem anderen grossen Gesinnungsblasenschreiber Lukas Bärfuss, von dem man auch noch kein ordnendes Wort zu den aktuellen Weltläufen gehört hat. So viel zu der gesellschaftspolitischen Verantwortung des Schriftstellers, die immer als Begründung herhalten muss, wenn mehr oder minder begabte Schreiber meinen, ihre persönliche Meinung zu diesem und jenem interessiere eine breitere Öffentlichkeit. Ach, und wo bleibt Sibylle Berg, die nach Plagiatsvorwürfen und leichten Zweifeln an der Authentizität von Reportagen auch deutlich leiser geworden ist.
Ein Treppenwitz im Treppenwitz ist, dass die Webseite von «Netzcourage» seit Tagen nicht mehr erreichbar ist, und ausser ZACKBUM ist das noch niemandem aufgefallen, bzw. keiner hält es für nötig, darauf hinzuweisen, dass nun Tausende, na ja, Hunderte, öhm, Dutzende, also eine Handvoll von Cybermobbing-Opfern unbeholfen und ungeholfen rumstehen. Ach, und es können wieder ungehemmt «Cockpics» verschickt werden, wovon angeblich bereits jede zweite Frau belästigt wurde. Nun kommt auch noch die andere Hälfte dran.
Vorbei, verweht, vergessen.
Sich prügelnde Eritreer, überhaupt Nachrichten aus den Elendslöchern dieser Gegend, aus Äthiopien, Sudan, Somalia, aber auch Tschad, Niger? Ach ja.Falsche Hautfarbe, keine nennenswerten Rohstoffe, Pech gehabt. Hat noch nie gross interessiert, interessiert aktuell überhaupt nicht. Armenier? Ach ja, die Armenier, war da nicht neulich was? Der religiöse Autokrat Erdogan, der die Errungenschaften Atatürks aus reiner Machtgier rückgängig gemacht hat und die Türkei ins Mittelalter zurückführen will, bombardiert als Kriegsverbrecher kurdische Lager in Syrien? Na und, ist aber doch in der NATO, hilft bei den Flüchtlingsströmen und daher ein Guter. Mohammed bin Salman, auf dessen Befehl hin ein Dissident unter Bruch aller diplomatischer Regeln in einer saudischen Botschaft brutal ermordet und zerstückelt wurde – nun ja, ein Freund des Westens, Waffenkäufer und Besitzer von Ölquellen. Da sehen wir ihm doch sein Gemetzel im Jemen auch gleich nach.
Vorbei, verweht, vergessen.
Hunderttausende von Kindern, denen bei der Kakaoernte Gegenwart und Zukunft gestohlen wird, die missbraucht, gequält, geschlagen, erniedrigt werden? Das wurde vom Läderach-Skandal überstrahlt, von der erschütternden Enthüllung, dass Läderach Senior als Mitglied einer Freikirchen-Sekte mitverantwortlich dafür war, dass vielleicht zwei oder drei Dutzend Zöglinge eines Internats ein wenig psychisch oder physisch misshandelt wurden.
Das Zurich Film Festival kündigte sofort erschreckt die Partnerschaft. Das gleiche Filmfestival, das den geständigen Vergewaltiger einer Minderjährigen Roman Polanski noch einige Jahre zuvor den Ehrenpreis fürs Lebenswerk überreicht hatte. Das gleiche Filmfestival, das ohne Skrupel solche Schoggi verteilt hätte, wenn das Problem nur darin bestanden hätte, dass sie mit ausbeuterischer Kinderarbeit gewonnen wird. Na und, Westafrika, Schwarze, who cares.
Vorbei, verweht, vergessen.
Israel, Israel, Israel. Ein bestialischer Überfall, das Abschlachten von Zivilisten. Das Vorgehen einer Mörderbande, wie es nur mittels der mittelalterlichen Todesreligion Islam möglich ist. Und schon wieder werden die Fundamente der Aufklärung in Frage gestellt. Es ist diskussionslos widerwärtig, dass in Deutschland (und in kleinerem Umfang auch in der Schweiz) antisemitische Ausschreitungen stattfinden. Wer die Sache Palästinas mit radikalfundamentalistischen Wahnsinnigen wie Hamas vermischt, ist ein Vollidiot und schadet der Sache Palästinas schwer. Aber wer Antisemitismus als wohlfeiles Totschlagargument gegen jede, auch gegen berechtigte Kritik an Israel verwendet, schadet einer fundamental wichtigen Sache unserer westlichen Gesellschaft: dem freien Diskurs. Der Überzeugung, dass nur im Austausch von Argument und Gegenargument, von Meinung gegen Meinung Erkenntnis und somit Fortschritt möglich ist.
Niemand hat das anschaulicher auf den Punkt gebracht als der ehemalige Pfaffenbüttel Giuseppe Gracia: «Wer Israel für Dinge kritisiert, die er bei anderen Staaten akzeptiert, ist ein Antisemit.» Wer Israel kritisiert, muss also zuerst Vorbedingungen erfüllen, die von Gracia und seinen Gesinnungsgenossen selbstherrlich aufgestellt werden. Wer Israel kritisiert, muss zuerst eine Litanei herunterbeten, welche anderen Staaten er auch kritisiert. Wer Israel kritisiert, muss zuerst Bekenntnisse ablegen. Zu oder gegen oder über. Sonst sei er Antisemit. Wer sagt «Israel verübt im Gazastreifen Kriegsverbrechen», dürfte das laut diesen Zensoren allenfalls nur sagen, ohne als Antisemit beschimpft zu werden, wenn er vorher sagt «Russland verübt Kriegsverbrechen in der Ukraine, die USA verüben Kriegsverbrechen überall auf der Welt, der Iran verübt Kriegsverbrechen, Saudiarabien, die sudanesische Regierung» usw. usf.
So wie früher die Inquisition forderte, dass Bekenntnisse abgelegt werden mussten, bevor in von ihr bestimmtem engem Rahmen Kritik an der Kirche geübt werden durfte. Bis man ihr dieses Recht wegnahm. So wie man es heute all diesen Anti-Aufklärern wegnehmen muss. Denn wer da zuschaut, wenn freie Rede beschränkt werden soll, ist das nächste Opfer.
Oder ganz einfach: grausame Kriegsverbrechen, die gegen Israel begangen werden, rechtfertigen, erklären, beschönigen nicht Kriegsverbrechen, die Israel begeht. Dass für persönlich Betroffene Hamas-Anhänger Tiere sind, die vernichtet werden müssen, ist menschlich verständlich. Dass der israelische Verteidigungsminister von menschlichen Tieren spricht, die als solche behandelt werden müssten, ist inakzeptabel. Ein militanter Israel-Verteidiger hat vor Kurzem in der NZZ eine richtige Frage gestellt: Wie kann Israel auf monströse Taten reagieren, ohne selbst zum Monster zu werden?
Auch beim Kampf gegen Monster darf man nicht selbst zum Monster werden. Auch gegen Palästinenser gab es Massaker, oder hat man die Namen Sabra und Schatila samt der üblen Rolle Israels bereits vergessen? Erinnert man sich schon nicht mehr an den Werdegang des aktuellen israelischen Ministerpräsidenten, den nur sein Amt vom Knast trennt? Entschuldigt, relativiert, verniedlicht, erklärt das die bestialischen Massaker der Hamas? In keiner Art und Weise. Aber es hilft dabei, nicht auf Stammtischniveau dumm zu schwätzen.
Das Schlimmste, was den Palästinensern in den letzten Jahren passiert ist, ist die Machtübernahme durch fundamentalistische Islamisten, durch Anhänger einer menschenverachtenden Todesreligion. Was Hamas will, ist Zerstörung, sie haben keinerlei positive Perspektive. Weder für Israel, noch für die Palästinenser. Was will aber Israel? Wo bleibt hier der gesunde Menschenverstand, der freie Diskurs, die konstruktive Debatte?
Einfache Frage: sollte es Israel gelingen, die Hamas zu liquidieren, wie es sein erklärtes Ziel ist: und dann?
Vorbei, verweht, unmöglich.