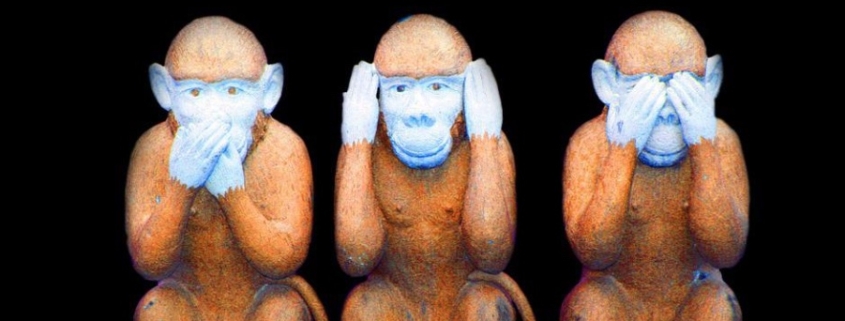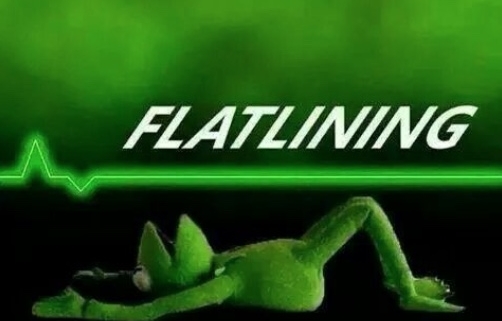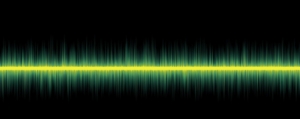Wir basteln uns einen Skandal
Recherchieren war gestern. Anonyme Quelle ist heute.
Was im Grossen schlecht ist, wird im Kleinen nicht besser. In einer unseligen Reihe von angeblichen «Leaks» und «Papers» schlachteten internationale Konsortien von Journalisten gestohlene Geschäftsunterlagen aus, die ihnen von anonymen Quellen zugespielt worden waren.
Ohne sich einen Moment die Frage zu stellen, welche Motive dahinterstecken könnten, aufwendig geraubte Datenberge mit ungeheuerlichem Erpressungspotenzial einfach wegzuschenken, versuchten die Journalisten dann mit viel Aufwand, daraus gigantische Skandale zu basteln. Die regelmässig verröchelten, bis ein Mitglied des sogenannten «Investigativ Desk» von Tamedia frustriert über einem «Skandal, der keiner wurde» jammerte. Weil nach der x-ten Wiederholung das Publikum sich gähnend abwandte.
Hier sind die Quellen anonym und trübe, aber was aus ihnen heraustropfte, war tatsächlich echtes Material, echte Hehlerware mit echten Namen und dann auch echten Opfern. Im Kleinen ist es allerdings noch viel schlimmer.
In der Affäre um die Anschuldigungen von Anuschka Roshani ist wenigstens die Motivation der Anklägerin klar. Sie wollte selbst Chefredaktorin des «Magazin» werden, scheiterte mit ihrer Blindbewerbung und scheiterte im ersten Anlauf mit ihren internen Vorwürfen gegen ihren Chef. Darauf sorgte sie dafür, dass es eine zweite Untersuchung gab, die aber leider auch zum Schluss kam, dass fast alle ihrer Behauptungen nicht erhärtet werden konnten. Das hatte dann die unselige Konsequenz, dass zwar ihr Chef gefeuert wurde, sie aber auch.
Nach Ablauf ihrer Kündigungsfrist holte sie dann zum grossen Schlag aus und hatte das Glück, bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber «Der Spiegel» eine Trommel zur Verfügung gestellt zu kriegen, mit der sie einen wahren Paukenschlag landen konnte.
In ihrer vierseitigen Anklageschrift kolportiert sie Anschuldigungen, die ihr offenbar zugesteckt worden waren. Natürlich ohne ihre Quellen zu nennen. Eine ist inzwischen enttarnt.
Was in dem Monat seit dieser Veröffentlichung geschah, ist ein weiterer Niedergang zu einem neuen Tiefpunkt der medialen Berichterstattung. Der Angeschuldigte wurde öffentlich hingerichtet, die Unschuldsvermutung bis zur Lächerlichkeit missachtet. Die Anschuldigungen wurden ungeprüft und unrecherchiert kolportiert. Aber damit nicht genug.
In allen Konkurrenzmedien wurden angebliche «anonyme Quellen» zitiert, die die Anschuldigungen Roshanis bestätigen würden, sogar behaupteten, es sei alles noch viel schlimmer gewesen. Nun weiss jeder Journalist, dass einer Quelle, die darauf besteht, nicht namentlich genannt zu werden, mit äusserster Vorsicht zu begegnen ist. Was sind ihre Motive, will da jemand als Heckenschütze Rache nehmen, wie stichhaltig sind seine Behauptungen? Kann er sie belegen oder ist es bloss Hörensagen?
Der Untersuchungsbericht exerzierte eine solche Quellenkritik in einem Fall vor. Und kam zum Ergebnis, dass die Behauptungen von Mathias Ninck nicht glaubhaft waren, nicht zutrafen, mit den Fakten nicht übereinstimmten. Oder in einem Wort: frei erfunden waren.
Ein ehemaliger redaktioneller Mitarbeiter des «Magazin» setzte einen Tweet ab, in dem er behauptete: «Wer es auf der Redaktion miterlebte, kann immer noch schwer begreifen, dass Canonica danach noch sieben Jahre länger Chefredaktor bleiben konnte.» Immerhin stand er mit seinem Namen dazu. Aber auf die Frage von ZACKBUM, was genau er denn miterlebt habe, verfiel Dominik Gross dann in tiefes Schweigen.
Machen wir doch ein rein theoretisches Beispiel. ZACKBUM würde behaupten, dass Pietro Supino unbefugt in die Kasse von Tamedia gegriffen habe, um die Renovation seines Luxusanwesens in Zürich zu finanzieren. Das würden mehrere, voneinander unabhängige Quellen bestätigen, deren Namen leider nicht genannt werden könnten, die aber glaubwürdig und mit dem Vorgang vertraut seien.
Supino würde sofort seinen Anwalt in Marsch setzen, der ohne Federlesens die sofortige Löschung dieser Behauptung und eine Entschuldigung fordern würde. Sich zudem weitere Schritte wie Verurteilung samt Schadenersatz ausdrücklich vorbehielte. ZACKBUM wäre sehr gut beraten, allen diesen Forderungen sofort nachzugeben, zu Kreuze zu kriechen und darum zu betteln, keinen Krach vor Gericht anzufangen.
Ausser, wir würden tatsächlich über Versicherungen an Eides statt plus entsprechende Dokumente verfügen. Aber die blosse Behauptung, darüber zu verfügen, reicht eben nicht. Da nützt auch die Berufung auf Quellenschutz nichts, wie schon Philipp Gut schmerzlich erfahren musste.
Denn der Trick ist einfach. Der Journalist selbst stellt eine ehrenrührige und geschäftsschädigende Behauptung auf. Dafür muss er den Beweis antreten. Er kann nun aber nicht den Trick verwenden, als Quelle einen Informanten anzugeben, den er mit Berufung auf sein Recht auf Quellenschutz leider nicht identifizieren könne, der es ihm aber mit heiligen Eiden versichert habe.
Im Fall Roshani kann nun der Schweizer Journalismus seine neuerlich verlorene Ehre und seine Glaubwürdigkeit nur zurückgewinnen, wenn Auskünfte über diese allgemein verwendeten «anonymen Quellen» erteilt werden. Zuvorderst sind da «Spiegel» und «Die Zeit» gefordert. Auch ZACKBUM gegenüber behauptet beispielsweise «Die Zeit», dass ihr die Quellen der einschlägig vorbelasteten Mitarbeiterin Salome Müller bekannt seien. Hand aufs Herz: das kann doch wohl nicht stimmen, behauptet ZACKBUM, ohne dafür eine andere Quelle als den gesunden Menschenverstand zu haben.
Denn es ist absurd anzunehmen, dass ein Journalist selbst seinem Verlag gegenüber die Namen seiner Quellen preisgäbe. Daher können wir der «Zeit» nur raten, dementsprechend auf Müller einzuwirken. Um dann ein blaues Wunder zu erleben. Denn Müller war schon Rädelsführerin, als vor ziemlich genau zwei Jahren 78 erregte Tamedia-Mitarbeiterinnen ein Protestschreiben verfassten, in dem sie mit über 60 Beispielen belegen wollten, welche frauenverachtenden, demotivierenden und sexistischen Zustände in ihrem Verlag herrschten. Nur: bis heute wurde kein einziges dieser anonymisierten Beispiele verifiziert …