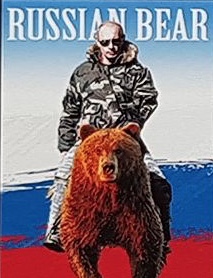Es war einmal «Das Magazin»
Im allgemeinen Elend gibt’s ein besonderes.
«Das Magazin», vormals nur Beilage beim «Tages-Anzeiger», war mal etwas Grossartiges. Riesenauflage (die inzwischen noch riesiger geworden ist), völlig losgelöst von Verkaufszwang, eine Spielwiese par excellence. Es war ein Ritterschlag, dort zu publizieren, und die Redaktion gab ihr Bestes, hohes Niveau in eigenen Beiträgen vorzulegen.
Dann ging’s bergab. Steil. Totengräber Finn Canonica begleitet den Niedergang ungerührt, verwaltet das Elend wie weiland Res Strehle im Mutterblatt. Sozusagen die Symbolfigur für den intellektuellen Sturzflug war Daniel Binswanger, der Woche für Woche Sottisen von sich gab, über die man sich ein Weilchen aufregte, bis man die Energie für die Lektüre sparte.
Seither entwickelte sich das «Magazin» immer mehr zu einer Beilage, die viele wie Werbebroschüren von Aldi oder Hotelplan aus dem mageren Samstagsblatt schütteln und entsorgen.
Wenn man das für einmal nicht tut, wird man bestraft. Zunächst ein Schrumpf-«Editorial», eine Paula Scheidt schreibt über das, worüber Journalisten immer lieber schreiben: ihre eigene Befindlichkeit, ihr Verhältnis zum Bewegtbild. Als lange Einleitung zur Titelstory des Hefts, die dann doch noch kurz erwähnt wird.
Auf der nächsten Seite schaut einen eine übellaunige Kaltërina Latifi an und beschwert sich über den angeblich «scheinheiligen Umgang mit Flüchtlingen» im Vereinigten Königreich. Sie lässt den Leser an ihrer Weltläufigkeit teilhaben «schlage ich die «Sunday Times» auf» und erwähnt lobend, dass Grossbritannien 1,3 Milliarden Pfund für die Ukraine bereitstelle. «Gut so, denke ich mir.»

Aber dann muss sie streng tadeln, es gäbe da so eine Abmachung zwischen GB und Ruanda, die ihr höchstes Missfallen erregt. Wie würde die Queen sagen: «we are not amused.» Latifi hingegen zeigt, dass sie es nicht so mit englischen Sprichwörtern hat: «You can have your cake and eat it.» Ist im Original etwas anders, aber original wird doch überschätzt.
Kaum hat man diese Ladung schlechter Laune hinter sich, gerät man vom Regen in die Traufe, oder in die Jauche, um auch hier abzuändern. Richtig, Konzernjournalist und Allzweckwaffe Philipp Loser hat nun das Wort. Auch sein Titel strahlt Optimismus aus: «Nein, nein, nein».
Wie häufig bei Loser, wenn er nicht Fertigmacherjournalismus im Auftrag seines Herrn betreibt, ist es nicht ganz einfach, seinen Gedankengängen zu folgen. Es geht irgendwie um das Stimmrechtsalter 16, oder dann doch um das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer. Dabei versteigt sich Loser zu eher dunklen Sätzen wie:
«Es ist nicht an jenen, die schon mitbestimmen, über jene zu urteilen, die das nicht dürfen.»
Himmel hilf dem Leser, das zu verstehen.
Als Nächste schaut einen Katja Früh miesepetrig an und schreibt – über sich selbst, worüber denn sonst. Ihre Tochter habe geheiratet, teilt sie dem Leser mit, als ob den das interessieren würde. Auch Früh interessiert das nicht wirklich, es ist nur die Einleitung, über ihre eigene Hochzeit zu schreiben – als ob das den Leser interessieren würde. Wer sich bis zum Schluss durchkämpft, wird damit belohnt, dass die Drehbuchautorin sich daran erinnert, dass eine Klammer mit Rückkehr zur Einleitung doch zum Standardrepertoire gehört.
Wir gönnen uns einen doppelten Espresso, denn wir haben noch «Kant oder Hegel» zu überstehen (wir lassen Gnade walten und ersparen diesen Sauglattismus dem Leser), ebenfalls das ungefilterte Gewäffel des «russischstämmigen Autors Alexander Estis». Oder wen interessieren Ausführungen über das «immer repressivere, faschistoide Regime in Russland»?

Dann folgt weiteres Nebensächliches, darunter eine gähnlangweilige Story über Kinder-Influencer. Dann ein Gewaltsstück über den sibirischen Permafrost. Wow, will man schon denken, bis man sieht: aus dem «New Yorker» eingekauft, auf fast 12 Seiten ausgewalzt, nicht mal selbst übersetzt. Copy/paste-Journalismus vom Schlimmsten.
Dann noch eine Seite vom ewigen Kolumnisten Max Küng, der halt seit Jahren aus Nichts ein Nichts machen kann, und das mit nichts. Genauer gesagt, eine Anreihung von belanglosen Nichtigkeiten. Bücherbrockenhaus, Spinnenkatalog, Lavabowle. Küng lesen, das ist wie in Zuckerwatte beissen. Nur nicht so süss.
Und damit, lieber Leser, ist entweder die aktuelle Ausgabe des «Magazin» zu Ende – oder ZACKBUM zu fertig, um weiterzumachen.

Das Schönste kommt doch immer am Schluss.