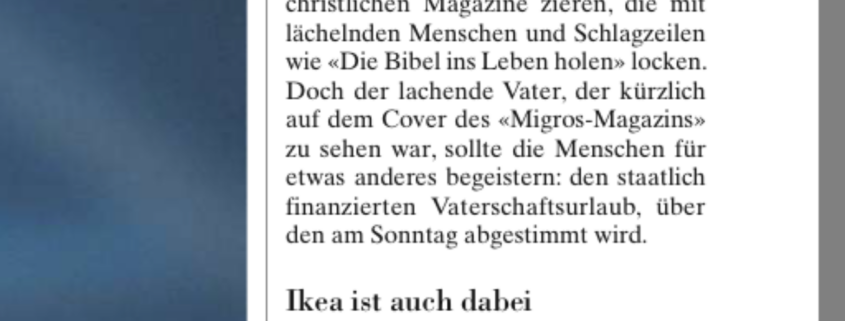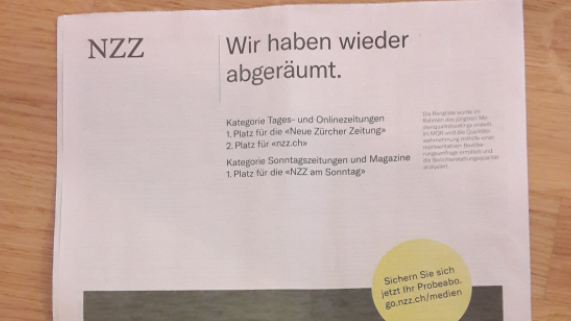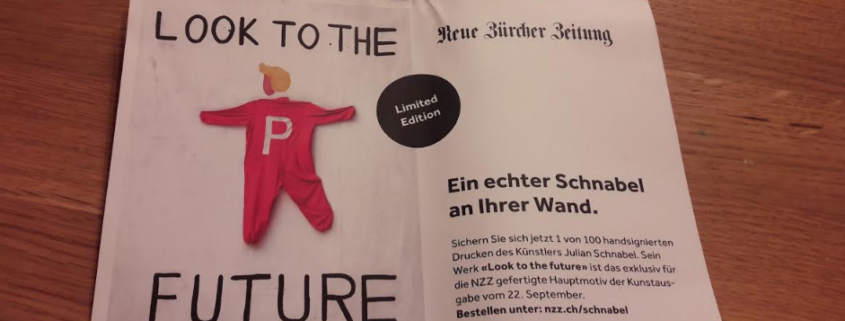Mahaharkt-Forschung
Wenn Medienhäuser ihre Kunden analysieren wollen.
Kann man die Unfähigkeit der Medienmanager an einem schöneren Beispiel illustrieren? Kann man eigentlich nicht.
Bezüglich Abfrühstücken des Werbefrankens im Internet durch die grossen Datenkraken Google, Facebokk & Co., da können sie wenigstens noch einwenden, dass das schliesslich weltweit ein Problem sei. Nach der Devise: Wir sind vielleicht bescheuert, aber die anderen auch.
Aber dieser Einwand zieht nicht bei einem anderen Thema, auch nicht ganz unwichtig. Wer liest die Medienprodukte, wo und wie? Das kann heutzutage, unglaublich aber auch, mit drei Methoden stattfinden.
Im Print gegen Bezahlung oder gratis, im Internet gegen Bezahlung oder gratis, über News-Aufbereitungschannels oder direkt.
Wie analysiert man den versprengten Leser?
Zumindest die ersten zwei Möglichkeiten werden in der Schweiz gemessen. Aber doch nicht einfach so, sonst wäre es ja kein Marketing-Tool für Deppen.
Da gibt es mal die Untersuchung «Total Audiance – die intermediale Währungsstudie». Immerhin hat die WEMF auch schon vom Wort crossmedial gehört. Wieso dieser Verein das Ganze aber Währungsstudie nennt, ist wohl ein süsses Geheimnis.
Dann gibt es noch die MACH Basic Studie. Die misst die Reichweiten der Schweizer Medien, allerdings nur auf Print beschränkt. Warum? Darum. Oder einfach, um die Zahlen mit der Vergangenheit vergleichen zu können. Denn die Existenz des Internets wurde von der WEMF längere Zeit ignoriert. Genauer gesagt bis 2015.
Was ist im Printbereich interessant?
Im Print ist für den Laien höchstens interessant, sollte er das nicht wissen, dass seit Jahren die Coopzeitung (2,4 Millionen) vor dem Migros-Magazin (2,2 Millionen) die mit Abstand meistgelesene Zeitung der Schweiz ist; dann kommt Betty Bossi und der Drogistenstern. Erst auf den Plätzen dann Konsumentmagazine wie Ktipp oder Beobachter.
Wir sind uns aber wohl einig, dass die gesamte Leserzahl nicht uninteressant wäre. Daher eben seit 5 Jahren «Total Audiance». Vorher? Gab’s da schon Internet?
Totale Einschaltquote wird vom gleichen Triumvirat angeführt
Also, hier wird sogar noch nach Print und online aufgeschlüsselt, aber die Gesamtzahlen sind signifikant fürs Ranking. Ähnlich wie bei den Printtiteln hält sich auch hier seit Jahren (oder seit gemessen wird) ein Triumvirat auf den vorderen Plätzen. «20 Minuten», «Blick», Tamedia. «20 Minuten» knackt dabei als einziges Medium die 2-Millionen-Schwelle, der «Blick» die «Million».
Danach folgen Tages-Anzeiger und NZZ. Wobei die NZZ mit online kräftig zugelegt hat; der Tagi erreicht 602’000 Leser, die alte Tante 553’000. Die Frage ist, wieso hier Bund/Berner Zeitung separat ausgewiesen werden, obwohl sie auch zum Newsnet gehören.
Aber wie auch immer, das sind mal einigermassen realistische Zahlen. Bei den Magazinen sieht es ganz anders aus, der Beobachter schwingt mit 1,8 Millionen vor der Schweizer Illustrieren (906’000) obenaus. Wieso das, obwohl Coopzeitung und Migros-Magazin schon alleine im Print mehr Leser haben? Man soll nicht grübeln.
Medien haben immer noch im Print die meisten Leser
Schliesslich ist noch interessant, dass die meisten Medien – grosse Ausnahmen inzwischen die NZZ und «Blick» – im Print immer noch mehr Leser haben als online. Das tut auch im Kässeli gut, weil Einnahmen aus Printinseraten grösstenteils bei den Printherausgebern landen.
Aber wo der Werbemarkt deutlich wächst, das ist natürlich im Internet. Während der Werbekuchen längere Zeit gedrittelt war; je eines Print, TV/Radio und online, plus noch DM und Plakate, wird bald einmal online alleine so gross sein wie der ganze Rest zusammen.
Das heisst dann, dass online mehr als 2 Milliarden Franken umgesetzt werden. Also ausgerechnet dort, wo die meisten Medienhäuser schwach auf der Brust sind. Und sozusagen weiterhin am meisten Geld mit Dampfloks verdienen, während die Elektroloks an ihnen vorbeizischen.
Nach den Werbeeinnahmen werden die Handelsplattformen abgetischt
Noch dramatischer wird es dann, wenn die Verlage merken, dass ihre teilweise für teures Geld gekauften Handelsplattformen, Immobilienanzeiger oder Stellenportale zuerst von Google und Facebook weggeräumt werden, bevor die sich zum Endkampf gegen Alibaba rüsten.
Freude herrscht im Mediengeschäft nur noch bei den Besitzerfamilien und auf der Teppichetage. Die einen ruhen sich auf dem Vermögen aus besseren Zeiten aus. Die anderen machen ein ernstes Gesicht und tun wichtig; als ob sie in den letzten 20 Jahren eine einzige zukunftsfähige Entscheidung getroffen hätten. Was man bei diesen Salären eigentlich erwarten könnte.