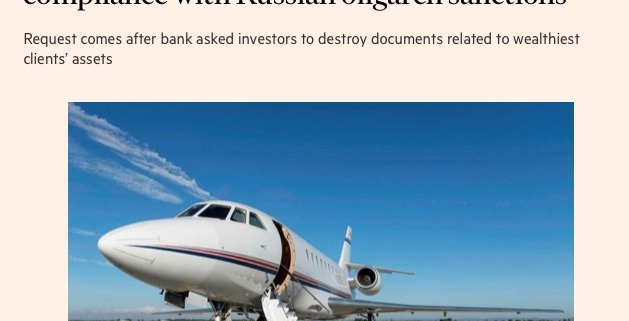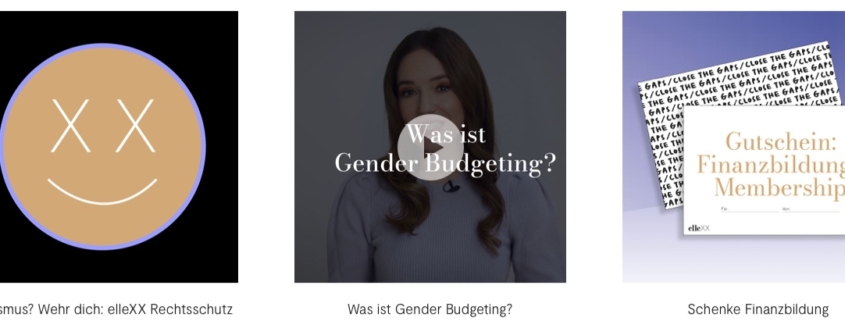Volles Rohr gegen «Inside Paradeplatz»
Die Credit Suisse hat nichts Besseres zu tun.
Eines der grossen Probleme im aktuellen Elendsjournalismus ist die Verrechtlichung medialer Arbeit. Schon immer versuchten Opfer oder Objekte medialer Aufmerksamkeit, mit dem Gang zum Kadi unliebsame Berichterstattung zu verhindern, zu unterdrücken, zu bestrafen.
Aber in den letzten Jahren ist das endemisch geworden. Einzelne Betroffene versuchen es mit einer Zangenbewegung, einer zivilrechtlichen Klage und einer Strafanzeige. Auch ZACKBUM ist Opfer dieser Unsitte. Die Absicht dahinter ist klar erkennbar. Es geht häufig nicht um die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, auch nicht um die Ahndung eines Unrechts. Es geht schlichtweg darum, ein Organ durch die entstehenden Kosten fertigzumachen.
Auch grosse Medienhäuser ducken sich immer häufiger feige weg, wenn mit juristischen Schritten gedroht wird. Der Tamedia-Konzern machte dem Autor dieser Zeilen schon mal anheischig, einen ohne dessen Kenntnis aus dem Netz genommenen Artikel wieder online zu stellen – wenn der kleine Journalist für den grossen Konzern das Prozessrisiko übernehmen würde. Auch das «Tagblatt» aus St. Gallen löschte einen unangreifbar recherchierten Artikel aus dem Netz – ohne dass der Autor vorab darüber informiert worden wäre. Ein reicher in St. Gallen beheimateter Clan hatte einen Büttel auf die Redaktion geschickt, der zum Ausdruck brachte, dass die Sherkatis nicht amüsiert seien. Das reichte.
Wie gross das Prozessrisiko war, bewies dann «Die Ostschweiz». Sie publizierte den unveränderten Artikel aufs Neue – ohne Reaktion der Betroffenen.
Drohungen mit finanziellen Forderungen nehmen heutzutage Überhand. So versucht eine hasserfüllte Kämpferin gegen Hass im Internet schon seit Längerem, den Ringier-Verlag zu einer Gewinnherausgabe zu zwingen, den er angeblich mit Artikeln über sie erzielt habe.
Genau diese Nummer probiert nun auch die grosse Credit Suisse gegen den kleinen Finanzblog «Inside Paradeplatz». Es geht um einen Streitwert von mindestens Fr. 300’000.- und die Herausgabe des Gewinns, den Lukas Hässig mit seiner unermüdlichen Berichterstattung über die Abwärtsspirale dieser Bank erzielt haben könnte.
Laut seiner Darstellung umfasst die Klageschrift satte 265 Seiten, plus Beilagen. Wie er konservativ ausrechnet, dürfte alleine das Erstellen externe Anwaltskosten von einer Viertelmillion verursacht haben.
Diese «Monster-Klage» richte sich gegen 52 Beiträge auf IP, also alle, die zwischen Ende Juli und Ende Oktober erschienen seien und das Wort CS enthielten. Die Persönlichkeitsrechte der Kläger, also der CS Group, der CS AG und der CS Schweiz AG, seien durch den Autor, durch Gastautoren oder durch Leserkommentare verletzt worden.
Natürlich wird auch Geschäftsschädigung ins Feld geführt, in der Schweiz umständlich als Verstoss gegen das Gesetz über unlauteren Wettbewerb (UWG) abgehandelt. Um die Gewinnherausgabe beziffern zu können, verlangt die CS zudem die Gesamtumsätze und die «Umsatzrendite», also einen vollständigen Einblick in die finanziellen Verhältnisse von IP.
Präventiv singt die CS zunächst das hohe Lied der Pressefreiheit, wie IP zitiert: «Die Klägerinnen sind dezidiert für die freie Presse und anerkennen die Medien als vierte Gewalt im Staat.» Dann kommt das dicke Aber: «Die Führungsequipe und damit die Klägerinnen werden der Lächerlichkeit preisgegeben, mit Beleidigungen überzogen und blossgestellt, und die Bankengruppe wird verächtlich gemacht, ja schlichtweg totgeschrieben, Kunden und Mitarbeiter werden gar aktiv zum Verlassen der Bank animiert.»
Damit will die Bankengruppe den aufmüpfigen Finanzblog totklagen. Als ob IP für den Niedergang der CS ursächlich verantwortlich wäre. Seit über 10 Jahren betreibt Hässig seine Plattform und hat in dieser Zeit eine beeindruckende Menge von Primeurs gesammelt. Unvergessen die Aufdeckung der Millionenabfindung für Vasella, einzig und allein dafür, dass der nicht bei einer anderen Pharma-Bude anheure. Dann der Skandal um den Starbanker Pierin Vincenz, den Hässig sozusagen im Alleingang zu Fall brachte, während die anderen Wirtschaftsmedien lange Zeit mit offenem Mund zuschauten. Dafür wurde Hässig zu recht als «Journalist des Jahres» ausgezeichnet, als dieser Preis noch etwas bedeutete.
Es ist richtig, dass Hässig in vielen seiner Artikel an die Grenzen des Erlaubten schreibt, das Wort Borderline-Journalismus fällt einem ein. Es ist auch richtig, dass sich frustrierte Banker unter Pseudonym in den Kommentaren austoben, dass es eine Unart hat. Leider ist der Betreiber einer Plattform – wenn es kein Social Media wie Facebook ist – auch für den Inhalt der Kommentare haftbar.
Einerseits ist es verständlich, dass es der CS mal den Nuggi herausgehauen hat, der von der UBS eingewechselte juristische Mastermind Markus Diethelm ist der wohl beste Legal Council, über den der Finanzplatz Schweiz verfügt. Auf der anderen Seite müsste man meinen, dass eine Bank, die in der gleichen Zeit, die ihre Klage bestreicht, nochmals 45 Prozent ihres Aktienwerts verlor und sich zeitweise auf dem Weg zum Billigpapier von unter drei Franken befand (von einmal über 90 Franken!), eine Bank, die von einem Skandal zur nächsten Bussenzahlung und zum nächsten Milliardenverlust wankt, eine Bank, die mit Asset-Abflüssen im Multimilliardenbereich zu kämpfen hat, eine Bank, deren Führungscrew nicht zu erkennen gibt, wie sie aus dieser Abwärtsspirale herausfinden will, eine Bank, bei der eigentlich nur noch die Boni üppig fliessen, dass eine solche Bank Wichtigeres zu tun hätte als ihren Frust an einem Finanzblog auszulassen.
Aber vielleicht ist das genau das Problem. Wenn’s im Grossen harzt und knarzt, wenn die Bank ständig mediale Prügel von grossen Finanzblättern wie der «Financial Times» oder dem «Wall Street Journal» einstecken muss, dann kommt sie auf die Idee, ihr Mütchen an einem kleinen Player zu kühlen.
Das hilft der CS in keiner Art und Weise aus der Krise. Viel Hirnschmalz, interne Ressourcen und die Dienste einer Grosskanzlei zu bemühen, um akkurat Dutzende von angeblichen Regelverstössen aufzuführen, das ist schlichtweg schäbig. Ärmlich. Und noch einiges mehr, was hier nicht formuliert werden kann, weil ZACKBUM nicht das Schicksal von IP teilen möchte.
Nicht nur, weil René Zeyer immer mal wieder (auch über die CS) auf IP schreibt, seien auch ZACKBUM-Leser dazu aufgefordert, kräftig auf das Konto zu spenden, das Hässig sicherlich demnächst veröffentlichen wird. Hier machen Spenden, im Gegensatz zu linken Furzprojekten, wirklich Sinn. Dass zumindest einzelne Kommentatoren mindestens die Grenzen des guten Geschmacks weit hinter sich gelassen haben – und dass Hässig ihnen eine Plattform bietet –, ist leider unbestreitbar.
Sollte es aber der CS gelingen, diese Perle der Wirtschaftsberichterstattung mundtot zu machen, wäre die Medienlandschaft der Schweiz deutlich ärmer und die Wirtschaftsberichterstattung noch lausiger, als sie es ohnehin schon ist.