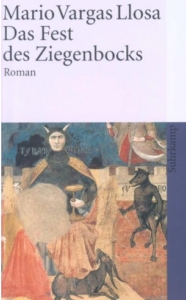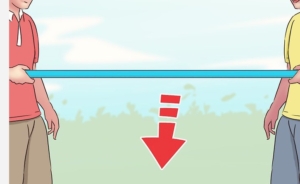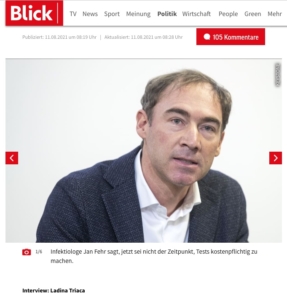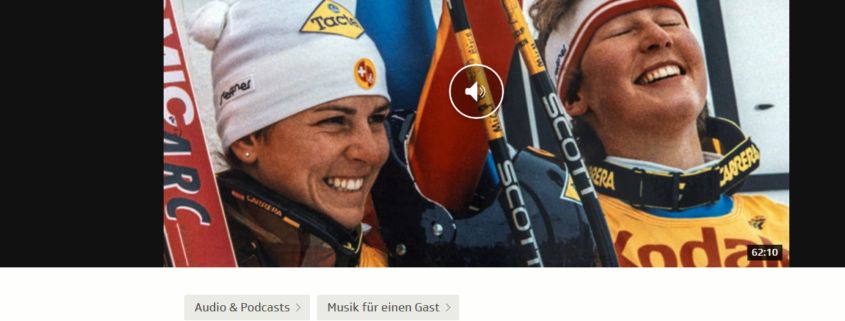Der entwickelt sich immer mehr zum wichtigsten Organ des Journalisten. Sein eigener, natürlich.
Tagi: Über die neuen 40
30 werden war früher, heute wird man 40. Hä? Muss man nicht verstehen. Aber man darf sich wundern, wieso Tamedia kein Extrablatt herausgebracht hat. Wir halten deshalb ein ganz heisses Thema für fürchterlich unterverkauft.
Denn: Haltet die Druckmaschinen an, die Seite eins kommt neu! Priska Amstutz, the one and only, hat ein Buch geschrieben. Das wurde auch gedruckt! Vom Knesebeck-Verlag in München, die Adresse für Buntes und Lebenshilfe. «Das neue 40» heisst das Meisterwerk. Unter Mithilfe einer Co-Autorin, mit vielen bunten Bildern und furchtbar interessanten Gesprächen mit schrecklich unbekannten Frauen – nur einer der Lieblinge von ZACKBUM ist dabei, die unvermeidliche Patrizia Laeri – lotet Amstutz aus, wie man sich denn so fühlt, ab 40. Als Frau.
«Das neue» oder «die neuen»? Ist doch egal
Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass diese Altersschallgrenze ja erst seit Kurzem immer wieder von Frauen durchbrochen wird. Man könnte nun entscheiden, ob man für die 240 Seiten stolze 39.90 bei Orell Füssli ausgeben will, oder 29.50 bei Exlibris. Oder ob man sich dafür nicht lieber einen neuen Lippenstift kauft. Ich als Mann würde Lippenstift wählen.
Kann nichts, muss weg.
Nun ist Amstutz (1977) auch noch Co-Chefredaktorin des «Tages-Anzeiger». Davon merkt man weiter nix, ausser, dass sie deswegen natürlich im eigenen Blatt von einer Untergebenen interviewt wird. Da gibt Silvia Aeschbach alles, um nicht ganz direkt zu sagen:
liebe Chefin, was wolltest du schon immer über dein tolles, neues Buch sagen?
Nein, natürlich wird zum strengen Sie gewechselt, und Amstutz werden Erkenntnisse von ewiger Gültigkeit und grosser Tiefe entlockt. Zum Beispiel; wie war’s denn so beim 40. oder 41. von Amstutz? «Ich realisierte plötzlich, dass ich am Anfang eines neuen Lebensjahrzehntes stand.»
Meiner Treu, ich gestehe plötzlich, dass ich diese Erfahrung auch schon machte. Sogar mehrfach. Aber deswegen schreibe ich doch kein Buch drüber. Und veranstalte auch nicht die Peinlichkeit, mich als Chef in meinem eigenen Blatt interviewen zu lassen. Selbst dann nicht, wenn sonst keiner von meinem Buch Notiz nimmt …
Eingeschlafene Füsse
Apropos niemand nimmt Notiz; was macht eigentlich die Kultur-Journalistin des Jahres? Simone Meier hatte doch auch ein Buch geschrieben, das immerhin auf Verkaufsrang 774 bei books.ch steht. Ach ja, das liebedienerische Interview auf «watson» ist schon durch, was gibt’s Neues?
Nun, als Kulturjournalistin muss man heute Allrounder sein, also hat Meier einen Film angeschaut. Der heisst «Sami, Joe und ich». Genau, drei Freundinnen aus der Agglo, ein wunderbarer Sommer, der dann doch nicht so wunderbar wird.
Das Werk hat nun nur ein – unverschuldetes – Problem. Es spielt 2019. Genau, seither hat sich auch bei Coming-of-Age-Filmen die Umwelt ein bitzeli verändert, was man nicht nur an den hier fehlenden Masken bemerkt. Nun hat sich Meier den Film aber angeschaut, dieses Erlebnis kann sie doch nicht einfach wegschmeissen. Gut, «warum nicht?» wäre eine Frage, die dem Leser viel Qual ersparen könnte. Also grübelte Meier lange, wie sie einen Film aus anderen Zeiten in die Gegenwart transportieren könnte. Glücklicherweise erinnerte sie sich an die Sentenz: dem Redaktör ist nichts zu schwör. Und da der Kampf gegen Sprachsexismus gerade Pause hat, bezog sie das auch auf sich.
Daraus entstand dann der wunderprächtige Titel: «Jugend ohne Corona ist auch ein Alptraum – im neuen Schweizer Teenie-Film».
Im nicht mehr so neuen Teenie-Film, während sich die Jugend heutzutage eher mit dem Problem rumschlägt, wie man dem Alptraum mit Corona entfliehen könnte. Aber vielleicht liegt es daran, dass Meier selbst diese Zielgruppe doch seit Kurzem verlassen hat.
Die NZZ und die letzten Fragen
Wie es sich für das Intellellenblatt für die geistig gehobenen Stände gehört, beantwortet die NZZ problemlos auch die letzten Fragen der Menschheit. Also zumindest in der Welt der Banker.
Denn, Überraschung, auch die UBS hat durch den Bankrott des Archegos-Fonds eine Stange Geld verloren. Aber die NZZ weiss Trost:
«800 Millionen sind nicht 5 Milliarden.»
Da sieht man mal wieder, was ein Black Belt in Accounting wert sein kann: auf diese messerscharfe Analyse kämen wir Banausen niemals. Aber die NZZ kann noch nachlegen: «Sie leichtfertig zu verspielen, ist dennoch nicht ratsam.»
Schade aber auch, nachdem ich gelernt hatte, dass schlappe 800 nicht 5 Mia. sind und gerade damit zum Casino aufbrechen wollte, erklärt mir die NZZ, dass das doch nicht ratsam sei. Gibt es denn sonst noch Fragen, vor denen wir wie der Ochs am Berg stünden, wenn die NZZ nicht Durchblick verschaffen würde?

Jein, muss man hier sagen. Denn schon der Titel dieses Ratgebers verwirrt: «Einmal keinen No Shrimp, bitte!». Leider reist die Autorin hier mit erkenntnistheoretisch eher leichtem Gepäck: «Wenn man ist, was man isst, was ist man dann, wenn man eine Nicht-Garnele isst? Oder ein Nicht-Ei, ein Nicht-Schwein oder ein Nicht-Chicken? Die vegane Küche konfrontiert uns mit verwirrenden Fragen.»
Wirklich? Das tut doch nicht erst die vegane Küche. Die Fragen waren damals auch überhaupt nicht verwirrlich, wenn der DDR-Bürger bei der Nahrungsaufnahme eine Sättigungsbeilage erhielt, zum damit gereichten Formfleisch. Der Name ist immerhin schon schöner als «Klebefleisch». Das bedeutete zum Beispiel, dass das «Jägerschnitzel» so wenig mit einem Jäger wie mit einem Schnitzel zu tun hatte. Es bestand aus zusammengeklebten Fleischstücken, die einfach in die Form eines Schnitzels gebracht worden waren.
Alte Erfahrungen, neu serviert: kalte Küche bei der NZZ
Das galt für viele Leckereien aus dem Nahrungsmittelfundus; auch für Fische, Wild, selbst für Mutters Klopse (Hamburger). Die bestünden ja schon aus gewolftem Fleisch, aber zum Strecken wurden gerne Produkte verwendet, die mit Fleisch eigentlich nichts zu tun hatten. Wenn sie auch farblich anders gestaltet waren, half die Lebensmittelchemie mit ein paar Farbtröpfchen nach. Das galt natürlich auch für die Delikatesse «Broiler» (Brathähnchen).
Steckte er am Drehspiess, konnte man einigermassen auf ein Originalprodukt vertrauen. Kam er aber in Einzelteilen auf den Teller, sah das schon ganz anders aus.
Also hier muss man leider sagen: NZZ, ungenügend. Das muss doch besser gehen. Der alte Scherz mit der Nicht-Existenz und deren existenzialistischen Folgen, da war ja Jean-Paul Sartre schon weiter.
«Blick» schickt Klartext durchs Rohr
Die einzige Zeitung der Welt mit einem Regenrohr im Titel verkünstelt sich nicht und überliefert glasklare Antworten. So ballert ein Titel: «Vanessa Mai platzt wegen der Kilo-Frage der Kragen». Weil der dann geplatzt ist, verwendet «Blick» ein Foto der Sängerin ohne Kragen, aber mit Einblick.
Wie äusserte sich denn das Platzen? Ziemlich ruppig:
«Geht Euch einen Scheiss an!»
Klare Frage, klare Antwort, völlig sinnbefreit. So lieben wir den Boulevard. Gibt er noch mehr Antworten? Aber hallo, jeden Menge. «Das sagen die Sterne». Exklusiv: Alpha Centauri plaudert im «Blick» aus dem Nähkästchen. «Die wichtigsten Grundsätze für den Roulette-Erfolg». Endlich, für alle Skeptiker, die immer noch meinen, dass nur die Bank gewinnt. Oh, ich sehe gerade, das ist ja eine «bezahlte Promotion mit jackpots.ch». Da kommt man doch ins Grübeln, wie objektiv diese Ratschläge sind.
Ein letztes Beispiel? Sicher, der «Blick» gibt ja nicht nur geistige Nahrung, er kümmert sich auch um die leibliche. «Das sollten Sie nicht täglich zum Frühstück essen», warnt Sonja Zaleski-Körner. Was denn nicht, und warum? Zum Beispiel «Pancakes mit Ahornsirup». Da werden Millionen von Schweizern aufhorchen, die sich das täglich gönnen. Aber es wird noch schlimmer: «Weissbrot oder Toast sättigen nicht lange und machen schnell dick.» Ob das Vanessa Mai weiss?
Aber wie steht es dann mit dem Inhalt einer brutzelnden Speckpfanne? «Wegen dem Fett und vielen Salz ist dieses Gericht leider nicht gesund.» Fett, was für Fett? Echt jetzt, das sollte man nicht zum Frühstück trinken? Wenn wir den «Blick» nicht hätten, wären viele von uns schon nach dem Z’morge halbtot.