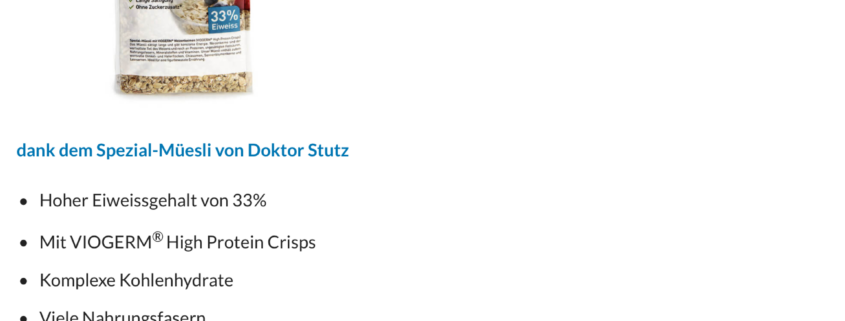Schweiz – Sklaverei. Ein neues Begriffspaar erobert die Medien.
In der Verhaltenspsychologie ist der pawlowsche Hund das Paradebeispiel für Konditionierung. Einer unbedingten Reaktion, beispielsweise dem Schwanzwedeln bei Freude, kann man eine bedingte Reaktion hinzufügen.
Das erreichte Pawlow, indem er immer eine Glocke ertönen liess, wenn einem Hund Futter gegeben wurde. Nach einer Lernphase begann der Hund auch dann zu sabbern, wenn nur die Glocke läutete – ohne Futter.
Auch Journalisten fangen an zu sabbern
Zurzeit passiert das Gleiche in der Schweiz mit dem Begriffspaar Schweiz – Sklaverei, Sklavenhandel. Moderndeutsch nennt man es nicht mehr pawlowschen Reflex, wenn Journalisten zu sabbern beginnen, sobald dieses Begriffspaar auftaucht. Sondern man nennt es das Entstehen eines Narrativs oder Framing.
Schubladendenken, die Herstellung einer vorhandenen oder neuen Assoziationskette. Eine vorhandene ist zum Beispiel die Farbe Gelb zu Zitrone, sauer. Allerdings gab es bis vor Kurzem keine Assoziationskette von Schweiz über Kolonialismus zu Sklaverei und Sklavenhandel. Denn bekanntlich hatte die Schweiz spätestens nach Marignano anno 1515 allen Grossmachtsfantasien abgeschworen; von da an verdingten sich Schweizer nur noch als Reisläufer fremden Herren.
Pas d’argent, pas de Suisses; nur noch die Bezahlung entschied, für wen die Eidgenossen in den Krieg zogen. Aber die Teilnahme an Eroberungszügen, an der Knechtung und Ausbeutung von Völkern in der Dritten Welt, aktive Beteiligung am Sklavenhandel, das warf niemand der Schweiz vor.
Niemand kam bis vor Kurzem auf die Idee, die Schweiz mit Sklaverei zu verbinden
Ein enges, zu enges Verhältnis zum Apartheitstaat Südafrika, das Lagern von Blutgeld und Reichtümern von Potentaten der Dritten Welt, das waren die schlimmsten Vorwürfe, die man der Schweiz machen konnte. Und dass sie Sitz von Handelshäusern war und ist, die die Warenströme der globalisierten Welt lenken.
Aber niemand, von wenigen Irrläufern abgesehen, wäre auf die Idee gekommen, der Schweiz eine Beteiligung an Sklaverei, an Sklavenhandel vorzuwerfen. Bis die «Black lives matter»-Welle auch über die Schweiz hereinbrach und sich mit dem Kampf gegen Klimaleugner ein Gefecht um die Lufthoheit der dringlichsten Anliegen lieferte.
Man sah auch in der Schweiz tapfere Eidgenossen niederknien, gebeugt unter jahrhunderteschwerer Kolonialschuld, und inbrünstig den Nonsense-Slogan skandierend, dass schwarze Leben Bedeutung haben. Es gab da aber anfänglich ein kleines Problem: Schuldbewusstsein, Leidensdruck, dafür braucht es nicht nur einen Slogan, sondern auch einen Grund.
Man muss heimisch leiden, nicht fremdleiden
Stellvertretend für die unterdrückten Schwarzen in den rassistischen USA leiden, das ist zwar ein Ansatz, aber viel besser wäre es, wenn man sozusagen heimisch leiden könnte. Daher probierte man es zunächst mit dem strukturellen Rassismus. Strukturell ist Rassismus, wenn er irgendwie ist, es aber schwerfällt, ihn dingfest zu machen. Auch der Stellvertreterkrieg gegen Begriffe, Mohrenkopf, Schwarzfahrer, Nickneger, vermochte diese Leerstelle nicht wirklich zu füllen.
Da erinnerte man sich daran, dass die Zeiten der Sklaverei und des Sklavenhandels doch schon länger zurückliegen. Zumindest in Europa und in den USA, denn in Schwarzafrika oder Lateinamerika hielt sich Sklavenhandel noch über viele Jahrzehnte, nachdem er von weissen Männern in aufgeklärten Staaten abgeschafft worden war.
Ein erster Durchbruch für die Sklavereiforschung
Also war es naheliegend, die Annalen der Schweiz zu durchforsten; da müssten sich doch Sklavenhändler, Besitzer von Sklaven, Ausbeuter von Sklaven finden lassen. Allerdings: die Suche gestaltete sich zäher als erhofft. Einen Durchbruch erzielte die Sklavereiforschung in der Schweiz erst, als sie den Neuenburger Mäzen David de Pury als üblen Sklavenhändler enttarnte.
Nun gut, der hatte fast sein ganzes Leben in Lissabon verbracht und als geschickter Geschäftsmann von der portugiesischen Krone gewisse Handelsmonopole erhalten. So ganz direkt war er dann auch nicht in Sklavenhandel verwickelt, man konnte ihm auch nicht vorwerfen, auf seinen Ländereien in der Dritten Welt Sklaven schuften zu lassen.
Schliesslich hatte er der Stadt Neuenburg auch ein gewaltiges Vermögen hinterlassen, als er kinderlos in Lissabon starb. Damit stellte die Stadt einige sinnvolle Dinge an und würdigte ihren spendablen Sohn auch mit einem Denkmal. Aber das muss natürlich weg, dieses Mahnmal für einen Sklavenhändler; Schande über ihn. Nun gut, die Monumente seiner spendablen Erbschaft, die müssen nicht unbedingt niedergerissen werden, denn auch heute noch gilt: pas d’argent, pas de Suisses.
Mit «ein de Pury» misst man nun die Schuldhaftigkeit
Damit war aber der erste Schritt im Framing geglückt. Wir haben einen Massstab gefunden, mit dem sich Schuldhaftigkeit in der Sklaverei messen lässt. Damit kann man skalieren. So entblödet sich die NZZ nicht, anlässlich der aktuellen Scheindebatte um angeblich dunkle Sklavereigeheimnisse Zürichs zu schreiben, dass Alfred Escher «nicht zu vergleichen» sei «mit Figuren wie dem Sklavenhändler David de Pury, dessen Denkmal mitten in Neuenburg zu Recht zur Disposition» stünde.
Damit will die NZZ immerhin das Escher-Denkmal vor dem Hauptbahnhof in Sicherheit bringen, dessen Abbruch selbstverständlich schon gefordert wird. In seltener Einigkeit mit dem «Tages-Anzeiger» fantasiert dann der NZZ-Kommentator wortgleich davon, dass «Zürich seit dem 17. Jahrhundert in mannigfacher Weise mit der Sklaverei verbunden» gewesen sei. Das müsse genauer erforscht werden, behauptet die NZZ, will aber gleichzeitig verhindern, dass diese Selbstbeschuldigung aus dem Ruder läuft: «Moral und Anklage braucht es dafür jedoch nicht.»
Wie soll man anders anklagen als aus heutiger Sicht?
Ein wundersamer Satz, ein entlarvender Satz, ein exemplarischer Satz, wie beim Umgang mit dem Thema Schweiz und Sklaverei es selbst der NZZ die Sinne verwirrt. Wie denn anders wird mit diesem Thema umgegangen als mit heutiger Moral und einem anklagenden Zeigefinger?
Anders ist das gar nicht möglich, denn als sich die Stadt Zürich an einer der damaligen Handelsgesellschaften beteiligte, so wie de Pury, war es weder moralisch verwerflich noch gesellschaftlich geächtet, Sklavenhandel zu betreiben. In Schwarzafrika existierte Sklavenhandel schon Jahrhunderte vor der Kolonisation, und dort existierte er auch noch, als die aufgeklärten Staaten Europas und die USA Sklavenhandel und den Besitz von Sklaven verboten.
Verstehen heisst nicht billigen der entschuldigen
Das macht die Beteiligung damals, und sei sie auch noch so gering gewesen, aus heutiger Sicht nicht weniger abscheulich. Aber eben aus heutiger Sicht. Geht man nicht wie die christliche Religion von einem über die Jahrhunderte und Jahrtausende unveränderlichen und unveränderten Menschenbild aus, dann muss man geschichtliche Epochen aus sich heraus verstehen, um Erkenntnisgewinn zu erzielen. Verstehen heisst natürlich nicht billigen oder entschuldigen. Es heisst aber auch nicht, billig mit der moralischen Überlegenheit der Jetztzeit damalige Verhaltensweisen und Einstellungen abzukanzeln.
Wie absurd das ist, kann man einfach mit einer Komplettierung der damaligen Mentalität exemplifizieren. Für de Pury war Sklavenhandel so selbstverständlich wie die Tatsache, dass der portugiesische König qua göttliches Recht über die Portugiesen herrschen durfte, ohne dass ihm Recht oder Gesetz Fesseln auflegen könnten. Für de Pury war es selbstverständlich, dass alleine durch königliche Geburt sein Nachfolger die Regentschaft übernehmen durfte. Für Escher war es selbstverständlich, dass Frauen weder in der Politik, noch in der Wirtschaft etwas zu sagen haben. Für ihn war es selbstverständlich, dass nur Besitzbürger politische Rechte haben. Für ihn war der Gedanke an Sozialwerke eine irrwitzige Forderung von verwirrten Geistern.
Escher als prägende Figur oder als Sklaventreiber?
Alfred Escher war für Zürich und für die Modernisierung der Schweiz eine prägende Gestalt von gewaltiger politischer und wirtschaftlicher Wirkungskraft. Dass er im Umgang kein angenehmer Mensch war und auch mit vielem scheiterte, so wie er vieles bewegte, das gehört zu seiner Biographie. Dass er zur Symbolfigur zu missraten droht, an der pawlowsche Reflexe antrainiert werden sollen, wenn es um die Herstellung einer Verbindung zwischen Zürich und Sklaverei, Schweiz und Sklavenhandel, Schweizer und Kolonialismus gehen soll, ist unerhört.
Ein Rückschritt, ein Rückfall, eine wahre Bankrotterklärung des Historischen Seminars der Uni Zürich, dessen Mitarbeiter sich für einen solchen unwissenschaftlichen Unfug wie der Spurensuche nach «mannigfaltigen Verwicklungen» Zürichs und der Zürcher in die Barbarei der Sklaverei sklavisch dem Zeitgeist gehorchend hingeben. Dass die NZZ ins gleiche Horn stösst, ist bedenklich.