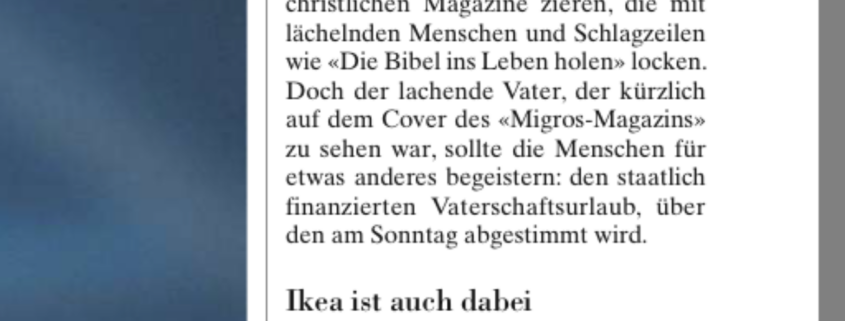Eine flog übers Kuckucksnest
Wo hört Realitätsverweigerung auf und beginnt Schlimmeres?
Lee Atwater, der für Ronald Reagan und George Bush Senior als Spin Doctor tätig war, also als Stratege, der einer Kampagne den richtigen Spin geben soll, sagte: «Perception is reality.» Die Wahrnehmung ist die Wirklichkeit.
Damit beschrieb er das fatale Phänomen, dass wir zwar einigermassen zweckrational in der Lage sind, die Wirklichkeit, so wie sie ist, wahrzunehmen. Aber häufig, ohne Beihilfe von aussen oder mit, halten wir unsere Wahrnehmung für die Wirklichkeit.
Solange dazwischen nur eine partielle oder leichte Abweichung existiert, ist das nicht weiter schlimm. Manchmal sogar hilfreich, wenn hässliche Menschen sich für attraktiv halten, Versager für Gewinner. Dem Selbstbewusstsein zuträglich ist immer, eine Niederlage in einen Sieg umzudeuten.
Ein Beispiel für die Wirklichkeit als Wahnvorstellung
Aber es ist ein gefährlicher Weg; links und rechts lauern Abgründe, und irgendwann fliegt man dann übers Kuckucksnest. Das ist der Titel eines der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Im englischen Original ist das ein Teil eines Kinderabzählreims, der Absurditäten aufeinanderstapelt; hier die, dass Kuckucks bekanntlich keine Nester bauen. Gleichzeitig bedeutet «cuckoo» im US-Slang irre, verrückt.
Ein bedenkliches Beispiel für Wirklichkeit als Wahrnehmung, besser als Wahnvorstellung, war die Berichterstattung über die Berufung von Jolanda Spiess-Hegglin ans Zuger Obergericht. In ihrem erbitterten Streit mit dem Ringier-Verlag. Das Gericht selbst fasste sein Urteil in einer Pressemitteilung mit Sperrfrist zusammen. Die «Berufung von Spiess-Hegglin wird vollumfänglich abgelehnt».
Bezüglich ihrer Forderung nach einer Entschuldigung wird das Gericht noch deutlicher: «Das Obergericht kommt wie schon das Kantonsgericht zum Schluss, dass Jolanda Spiess-Hegglin kein klagbarer Anspruch auf Publikation einer Entschuldigung der Ringier AG zusteht.» Das Obergericht sah zwar auch eine Persönlichkeitsverletzung, kürzte aber die dafür fällige Genugtuung nochmals auf die Hälfte der Vorinstanz. Statt den ursprünglich geforderten 25’000 Franken erhielt Spiess-Hegglin nur 2/5 oder 10’000.
Warum gab es keinen Weiterzug ans Bundesgericht?
Warum das der Medienbüttel von Spiess-Hegglin unter Brechung der Sperrfrist als rauschenden Erfolg beschrieb, hat zumindest mit kompetenter Berichterstattung nichts zu tun. «Jolanda-Spiess-Hegglin gewinnt gegen «Blick»», titelte er. «Vollumfänglich abgelehnt» übersetzt man normalerweise mit Klatsche, verloren, abgeschmettert. Aber mit den Fähigkeiten dieses publizistischen Leiters muss sein Verlag leben, wir nicht.
ZACKBUM.ch wollte von Spiess-Hegglin wissen, warum sie nach dieser Niederlage das Urteil nicht ans Bundesgericht weitergezogen habe. Wäre zumindest logisch und naheliegend. Ihre Antwort ist, gelinde gesagt, irritierend: «Meine Forderung im Berufungsverfahren nach einer Entschuldigung seitens Ringier AG wurde vollumfänglich erfüllt.»
Ähm. Ihre Berufung wurde abgeschmettert. Insbesondere hielt das Gericht fest, dass ihr kein Anspruch auf eine Entschuldigung zusteht. Richtig ist hingegen, dass sich der CEO des Ringier-Verlags nach Kenntnis des Urteils dennoch bei ihr entschuldigte. So wie sich Spiess-Hegglin wortreich bei einem «Weltwoche»-Journalisten entschuldigte, nachdem sie ihn als Favoriten in ihrem «Arschloch-Wettbewerb» bezeichnet hatte.
Das alles hat nun aber mit dem Berufungsverfahren nicht das Geringste zu tun. Zudem wurde auch nicht nach dem Thema Entschuldigung gefragt, sondern nach einer Begründung, wieso die Niederlage nicht appelliert wird.
Der Wunsch, die Wahrnehmung für die Wirklichkeit zu halten
Aber damit nicht genug der Absonderlichkeiten. In ihrer Echokammer auf Twitter, wo sie sich selbst und ihre Hardcore-Anhänger gegenseitig in Realitätsverweigerung überbieten, behauptete Spiess-Hegglin unlängst, «mir flog da etwas in die Hände». Nämlich ausgerechnet ein «Blick»-Artikel, der eine Woche nach der weinseligen Feier erschien.
Er sei «komplett erfunden», behauptet Spiess-Hegglin, die beiden Autoren fragt sie, warum sie denn die im Artikel «aufgestellten Behauptungen nicht verifiziert» hätten. Sie wolle wissen, wer die Journalisten «gezielt mit Lügen versorgt» habe. Der Artikel stütze sich «auf Aussagen von Zuger Kantonsräten, welche anonym bleiben wollten. Sprich: es wurden gezielte Lügen als Tatsachen verkauft.»
Das ist nun schon etwas mehr als der Wunsch, die eigene Wahrnehmung für Wirklichkeit zu halten. Denn der Inhalt dieses Artikels von anno 2014 ist in allen wesentlichen Teilen durch die Einstellungsverfügung in Sachen des mutmasslichen Schänders erstellt. Zudem ist dieser Artikel Bestandteil des Prozesses um Gewinnherausgabe gegen den Ringier-Verlag, den die Anwältin von Spiess-Hegglin losgetreten hat.
Wie steht es mit der Mitverantwortung?
Es ist also schwer vorstellbar, dass der Artikel vom 27. 12. 2014 ihr einfach so vorgestern in die Hände «geflogen» sei. Es ist noch schwerer vorstellbar, dass Spiess-Hegglin nicht weiss, dass sein Inhalt keineswegs «komplett erfunden» ist.
Wenn man all diese Mosaiksteine zusammensetzt, nimmt ein besorgniserregender Realitätsverlust Gestalt an. Eine Mitschuld daran muss man all denjenigen zumessen, die Spiess-Hegglin in ihrer Wahrnehmung der Realität bestätigen und unterstützen. Das kann man inzwischen nur noch als verantwortungslos und grobfahrlässig bezeichnen.