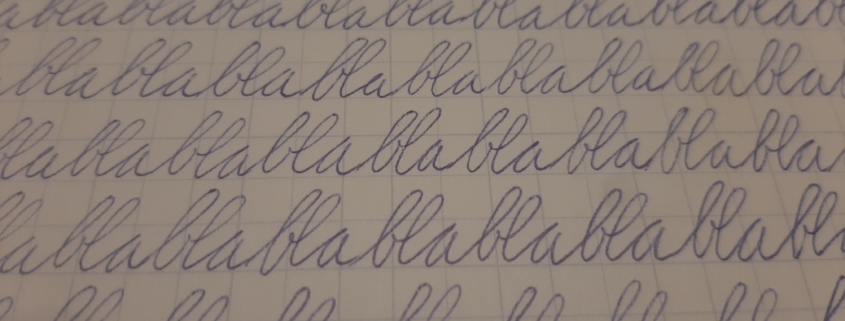Ringier baut ab. Tamedia baut ab. CH Media baut ab. NZZ baut ab.
Als festangestellter Redaktor muss man sich in der Schweiz als unfreiwilliger Teilnehmer am Kinderspiel Reise nach Jerusalem sehen. Die Musik hört immer häufiger auf zu spielen, und immer hat es einige Stühle zu wenig.
Gerade hat es die «Schweizer Illustrierte» erwischt. Ihr Ableger «Style» wird eingespart, online und Print zusammengestöpselt. 35 Stellen fallen weg. Damit spart Rasch, also Ringier Axel Springer Schweiz, über den Daumen gepeilt rund 3,5 Millionen Franken pro Jahr ein.
Originelle Begründung: allgemein sinkende Werbeerträge und dann noch Corona. Damit stimmt Ringier in den allgemeinen Chor ein, der wie in einem Abzählreim singt: Stellenabbau, Stellenabbau, Stellenabbau.
Die Chöre singen immer die gleichen Strophen
Gleichzeitig wird der Gegenchor in Stellung gebracht: Content, Qualität, vierte Gewalt. So leiern beide Chöre vor sich hin, um sich am Schluss zum Finale zu treffen: Hilfe, wir brauchen Geld, Geld, Geld.
Subventionen, staatliche Hilfe, Anteil am Gebührentopf für SRF, schliesslich erbringen die privaten Medienhäuser eine gesellschaftlich relevante Dienstleistung. Denn hier werden ja keine Schrauben gedreht, sondern es wird kompetent, seriös und vertrauenserweckend recherchiert, analysiert, kommentiert.
Ach ja? Bei CH Media, der einen Hälfte des Duopols, das den Deutschschweizer Tageszeitungsmarkt unter sich aufteilt, arbeiten laut Selbstauskunft 45 Redaktoren in der Zentralredaktion in Aarau. Gleich beim Zusammenschluss der ehemaligen NZZ-Lokalzeitungen mit dem Wanner-Konzern fielen mal 5 Stellen weg. Natürlich bedauerlich, aber wie sülzte der publizistische Leiter Pascal Hollenstein: «Das Angebot wird besser, der Journalismus gestärkt.»
Stärken durch Einsparen
Deutlich gestärkt ist zum Beispiel das Ausland; laut Impressum bestreichen hier zwei Allrounder die ganze Welt. Von Norwegen bis Südafrika. Von Alaska bis Chile. Von Moskau bis Peking. Zu einer anderen Lösung hat sich Tamedia entschieden. Im Impressum sieht das Auslandressort wohlbestückt aus. 5 Redaktoren, 22 Korrespondenten. Immerhin. Nur: Die Auslandberichterstattung wird weitgehend von der «Süddeutschen Zeitung» aus München übernommen. Sind ja auch grösstenteils deren Korrespondenten.
Beim «Blick», Pardon, bei der «Blick»-Verlagsgruppe ist gar kein Ausland mehr separat ausgewiesen. Eine Liga für sich ist immerhin noch die NZZ. Aber: Wie soll das gehen, mit ständigen Rausschmeissrunden den Journalismus stärken? Mit immer weniger Redaktoren immer mehr Output, online und Print, rauspusten?
Nun, die Arglist der Zeit, das Internet, die Pandemie, wer konnte das denn ahnen? Jeder, ausser, er ist Medienmanager. Der Bankier Julius Bär machte sich in seiner Zunft äusserst unbeliebt, als er richtig feststellte, dass das Bankgeheimnis zwar fett, aber auch impotent mache.
Über viele Jahrzehnte war der Besitz einer Druckerei eigentlich die Lizenz zum Gelddrucken. Stellenanzeiger, Wohnungsanzeiger, Werbung jeder Art: nur der Schlitz der Bezahlboxen und die Druckmaschinen waren die Grenze nach oben, was den Umfang betraf.
In den fetten Zeiten fett geworden
Chefredaktoren, vor allem, wenn sie erfolgreich waren, fuhren Porsche, Reporter flogen Business durch die Welt, beachtliche Gelage wurden als Informationsgespräch auf die Spesenabrechnung gesetzt, und keiner meckerte deswegen. Die drei Besitzerfamilien, die Coninx, Wanner und Ringier, waren mit Geldzählen beschäftigt, legten sich hübsche Kunstsammlungen zu und fuhren Aston Martin oder Rolls-Royce.
Schönwetterkapitäne halt. Dann rüttelte das Internet die ganze Branche durch, die ganzen schönen Kauf- und Tauschbörsen verschwanden ins Digitale, mitsamt einem immer grösseren Stück vom Werbekuchen. Geschäftsmodell kaputt, obsolet geworden. So wie die Kutsche beim Aufkommen des Automobils. So wie die Dampflok gegen die Elektrolok.
Was fällt den Schönwetterkapitänen ein?
Nun könnte man meinen, dass die Besitzer aufhörten, die Scheinchen zu zählen und mehr oder minder sinnvoll auszugeben, ihre Managerriege unter Beweis stellte, dass sie zu mehr taugt als zur Verwaltung des Althergebrachten.
Leider doppelte Fehlanzeige. Gesundbeten und totsparen. Das fällt ihnen bis heute ein. Um Subventionen betteln, das fällt ihnen auch noch ein. Ach, und ganz clevere Medienmanager kamen noch auf die grossartige Idee, den abschwirrenden Inseraten einfach nachzurennen. Und für teures Geld alle möglichen Plattformen im Internet zusammenzukaufen.
Dazu Radiostationen und TV-Stationen. Das verkauften sie dann dem staunenden Publikum als multimedial, als crossmedial, als ganz neue Wertschöpfungsketten. Online-Redaktionen wurden aus dem Boden gestampft und neben die traditionelle Printredaktion gesetzt. Multichannel, you know, verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Medien, müssen alle spezifisch bespielt werden. Online-Marketing, ein Riesending.
Trennen und zusammenlegen
Als auch das nicht viel half, kamen die Manager auf die nächste uralte Idee: Legen wir zusammen, was wir getrennt haben. Online, Print, Radio, Video, ist doch kein Kunststück, wenn das der gleiche Journalist bespielt. Mikrophon und Handy-Kamera kann doch jeder Depp bedienen.
Das schon, aber wie gross ist das Ausmass der Dummheit in den Chefetagen der Medienhäuser? Das World Wide Web gibt es nun auch schon seit 30 Jahren. Eine Generation lang. Und ist den Medienmanagern eine Antwort dazu eingefallen? Nein. Vom Online-Werbekuchen schneiden sich die Platzhirsche Google und Facebook & Co. 90 Prozent der Einnahmen ab. Reaktion? Null.
Der Grösste räumt die Kleinen weg
Und die grossartigen Kauf- und Tauschplattformen von Tamedia und Ringier? Auch nicht mitgekriegt, dass im Internet gilt: the winner takes it all? Der Grosse macht den Kleinen platt. Google und Amazon räumen alles weg. Bis Alibaba die beiden wegräumt. Von den Zwergplattformen in der Schweiz gar nicht zu reden.
Also zurück zum Sesselspiel. Lassen wir die Journalisten mal wieder im Kreis laufen. Und nehmen ihnen ein paar Stühle weg. Nächste Rausschmeissrunde. Das stärkt den Journalismus.