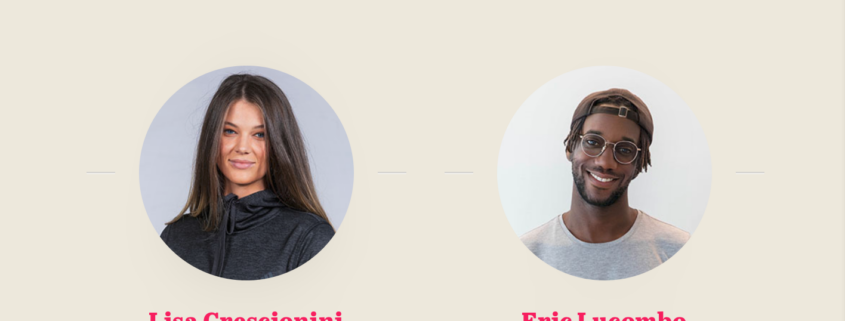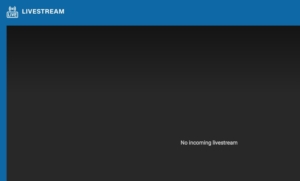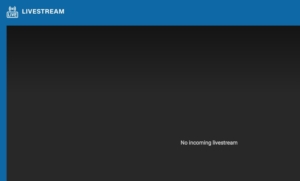
So sieht das Ende aus; nicht einmal ein Abschied in Würde.
CNN Money Switzerland ist kaputt. Die Hintergründe.
Als ich mich kurz nach dem Start bei CNN Money Switzerland umschaute, herrschte die übliche, lustvolle, motivierte und mit viel Herzblut angereicherte Atmosphäre eines typischen Start-up.
Urs Gredig als Chefredaktor verbreitete gute Laune, was auch seinem Gemüt entspricht. Mit Martina Fuchs hatte sich der Sender eine Schweizer Anchorwoman geholt, die hierzulande gerade Furore machte; als vormalig einzige ausländische Moderatorin im chinesischen Staats-TV.
Eher ranziger Stimmung war schon damals der CEO Christophe Rasch. Besonders, wenn man ihn darauf ansprach, wie denn der Sender eine für Werbekunden interessante Reichweite bekommen könne. «Ich pumpe doch nicht meine Zahlen auf, indem ich nackte Frauen auf die Webseite stelle», fetzte er zurück.
Schwarze Zahlen nach einem Jahr
Offensichtlich meinte er, seine bisherigen Erfahrungen im Bereich elektronische Medien würden es ihm ermöglichen, Wunder zu vollbringen: «Wir glauben, dass wir im ersten Jahr Break-even erreichen können», tönte Rasch kurz nach dem Start.
Das sei eben ein Multichannel-Projekt, nicht einfach ein TV-Kanal, wer nicht sehe, dass so ein Sender gewaltiges Potenzial habe, verstehe halt nichts vom Geschäft. Seinem offensichtlich gut entwickelten Selbstbewusstsein tat es auch keinen Abbruch, als auch nach einem Jahr die Einschaltquote unterirdisch blieb, kaum jemand von der Existenz von CNN Money Switzerland wusste, und Break-even natürlich in weiter Ferne lag.
Nach zwei Jahren zogen sich dann Martina Fuchs und Urs Gredig zurück. Geräuschlos, ohne das übliche Absingen schmutziger Lieder. Wer den Eindruck bekommen könnte, dass es mit dem Sender langsam Richtung Absturz gehe, dem stellte Rasch ein neues TV-Studio in der Westschweiz und die Verpflichtung von Patrizia Laeri als neue Chefredaktorin entgegen.
Eher befremdliche Investoren
Unwirsch reagierte Rasch auch immer bei Nachfragen bezüglich seinen Investoren. Da wird’s ein Momentchen kompliziert. Am Anfang war der ehemalige Rothschild-Banker Julien Pitton als VR-Präsident an Bord der AG. Als Berater einer asiatischen Holding brachte er die Brüder Sikder aus Bangladesh dazu, in dieses Start-up zu investieren. Weiter an Bord ist der Wirtschaftsanwalt Christophe Wilhelm, mit dem Rasch über seine PR-Agentur Media Go verbunden ist.
Weiter im VR sitzt Sameer Ahmed, ebenfalls ein Geschäftsmann aus Bangla Desh, Gründer und CEO von RSA Capital. Die Firma verfügt über eine nett gestaltete Webseite, aber ihre E-Mail-Adresse ist ungültig, und Antworten tut sie auch nicht, wenn man sie auf anderen Wegen zu erreichen versucht.
Wilhelm taucht inzwischen im Organigramm im Handelsregister nicht mehr auf. Wie sich die Investoren aus Bangla Desh und Rasch das Aktienkapital von ausgewiesenen 133’500 Franken aufgeteilt haben, ist nicht bekannt, ebenso wenig Umsatz oder allenfalls Gewinn. Es ist allerdings offensichtlich, dass die Geschäftsleute aus Bangla Desh mehrfach Geld nachschossen, um die laufenden Kosten und die Expansionspläne von Rasch zu finanzieren.
Die wichtigsten Investoren auf der Flucht?
Laut lokalen Presseberichten ist es aber so, dass die Gebrüder Sikder schon im Mai ihr Land überstürzt verlassen haben und mit einem firmeneigenen Jet nach Thailand flüchteten. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten mehrere Bankmanager mit dem Tode bedroht, weil die sich geweigert haben sollen, eine Immobilie der Sikders weit oberhalb des Marktwerts zu beleihen.
Seither melden sich die Gebrüder gelegentlich aus dem Exil, worauf die Justizbehörden von Bangla Desh sehr unwirsch reagieren. Das alles hinderte Rasch dem Vernehmen nach nicht daran, mit seiner Lebensgefährtin, einer Schwester des Pictet-Bankers Boris Collardi, standesgemäss luxuriöse Sommerferien zu verbringen. Zur Verbitterung der Angestellten, die seit Anfang Juli auf ihre Gehälter warten, habe Rasch Fotos davon in seinen Facebook-Account gestellt. Sie sind inzwischen gelöscht.
Boris Collardi, der als Wunderknabe von Bär zur diskreten Privatbank Pictet als Teilhaber wechselte, ist inzwischen auch in eher stürmischen Gewässern. Während er sein neues Büro in den ehemaligen Räumen der verblichenen Bank Leu an der Bahnhofstrasse Zürich bezog, rümpfte die Bankenaufsicht öffentlich hörbar die Nase über schwere Mängel in der Bekämpfung von Geldwäscherei bei der Bank Bär – genau in den Jahren, in denen Collardi dort als CEO Neugeld wie Heu hereinschaufelte.
Schnell schrumpfte Rasch auf Normalgrösse
Also rundum gewittert es, und Rasch schrumpfte atemberaubend schnell von einem visionären Geschäftsmann zu einem Versager, der nun natürlich der Pandemie und den düsteren Zukunftsaussichten im Medienmarkt die Schuld an dem Ende von CNN Money gibt.
Deshalb habe er auch bei der Krisensitzung von letztem Sonntag für das Aus gestimmt, gibt er knapp bekannt. Der Ball liege nun beim Konkursrichter, der Sender stelle demnächst seinen Betrieb ein. Das hat er bereits, aber auch das muss der Aufmerksamkeit von Rasch entgangen sein.
In mehr als zweieinhalb Jahren ist es ihm, trotz zusätzlicher Finanzspritzen, weder gelungen, seinen Sender auf die Landkarte zu heben, noch Einkünfte zu generieren, die den satten Kosten von zwei hochprofessionellen Studios und 27 Mitarbeitern auch nur im entfernten auf Augenhöhe begegnen.
Mal wieder Millionen verröstet
Eine Burn-rate von einer runden Million Franken pro Monat wies Rasch damals als «viel zu hoch» zurück, aber die richtige Zahl wollte er nicht nennen. Wer sich im Business etwas auskennt, hält eine Million für Sendungen auf diesem Niveau für durchaus realistisch.
Nun müssen sich die Mitarbeiter, ausgerechnet in dieser Situation, neue Arbeitgeber suchen. Und sich eine Antwort auf die Frage überlegen, was sie eigentlich die letzten zweieinhalb Jahre gemacht haben. Rasch könnte das problemlos tun: Er hat sinnlos und viel zu lange sehr viel Geld verbrannt. Dass es so nicht funktionieren kann, war schon lange vor der Pandemie sonnenklar.
Siehe auch hier.