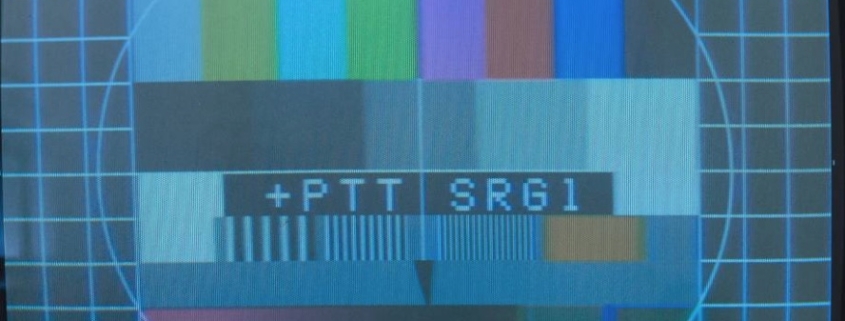Die Medienreaktion auf Schawinskis Buch: wird nicht peinlich geschwiegen, wird peinlich geschrieben.
Roger Schawinski hat fulminant die Skandalgeschichte um eine verschmähte Frau aufgeschrieben. Wer sein Buch «Anuschka und Finn» liest, bekommt eindrücklich vor Augen geführt, wie banal, ärmlich und unappetitlich die ganze Story ist. Eine privilegierte Journalistin sieht das Ende ihrer Arbeitszeit kommen und will noch den einzigen Karrieresprung machen, der ihr möglich erscheint.
Sie will Chefredaktorin des «Magazin» werden, weil sie das Gefühl hat, sie könne das besser als der Amtsinhaber. Also macht sie zwei Dinge. Sie beschwert sich intern über ihn und bewirbt sich auf seine Stelle. Der erste Mobbing-Versuch schlägt fehl, ihre Bewerbung wird abgeschmettert. Daraufhin lässt sie über die Bande spielen, benützt das Beziehungsnetz ihres Mannes, um nochmals ihre Vorwürfe in den Verwaltungsrat von Tx einzubringen.
Zweite Untersuchung, noch gründlicher, gleiches Resultat. An ihren Vorwürfen gegen Finn Canonica ist (fast) nichts dran. Aber nun stellt der Untersuchungsbericht zu Recht fest, dass angesichts der Massivität ihrer Falschanschuldigungen ein weiteres gedeihliches Zusammenarbeiten nicht mehr möglich sei.
Also wird zunächst, unglaublich, der Chefredaktor entsorgt. Aber nach einem kurzen Moment des Triumphs und der Hoffnung, nun doch den Chefsessel besteigen zu dürfen, kommt die kalte Dusche: auch Anuschka Roshani wird gefeuert.
Sie wartet noch die Kündigungsfrist mit Nachzahlung ab, um dann öffentlich im «Spiegel» Rache zu nehmen. Wie peinlich für das Organ, bei dieser klaren Motivlage auf den Bericht reinzufallen und ihn zu publizieren. Noch peinlicher: inzwischen wurden dem ehemaligen Nachrichtenmagazin die weitere Publikation von neun Textstellen im Racheartikel von Roshani untersagt (das Urteil ist noch nicht rechtskräftig). Noch peinlicher: bei der Gerichtsverhandlung konnte der «Spiegel» kein einziges der behaupteten «Dokumente» vorlegen, die Roshanis Darstellung stützen sollen. Auch an Zeugenaussagen – ausser Roshani, ihr Mann und eine wegen Fehlverhaltens entlassene Redaktorin ist da nix – mangelt es.
Geht’s noch peinlicher? Oh ja, wenn wir die Medienresonanz auf Schawinskis Buch anschauen. Die Prognose war nicht schwerer als nach der Publikation des Untersuchungsberichts über Uni-Studentinnen. Schweigen oder Verriss.
Tiefes Schweigen bei NZZ und «Blick». Einfach nichts, dabei wird sonst jeder Seufzer im Mediengefüge kolportiert. Aber ein Buch über den wohl grössten aktuellen Medienskandal der Schweiz – nichts. Wie alle Medien Roshani auf den Leim krochen, wie auch in der NZZ und beim «Blick» und anderswo («alles noch viel schlimmer») Zeugenaussagen erfunden wurden, Canonica zum wahren Monster aufgeblasen wurde, jede Behauptung gegen ihn für bare Münze genommen wurde – ein Skandal im Skandal.
Aber Selbstkritik war noch nie die starke Seite der Medien.
Noch schlimmer als das Schweigen der Belämmerten sind die Wortmeldungen. Sie sind überschaubar. Die «SonntagsZeitung» titelt:

Früher hätte man dem Autor oder dem Produzenten einen solchen Titel um die Ohren gehauen und gesagt, dass es vielleicht noch gut wäre, auf den Kern des Buchs einzugehen, nicht auf einen Nebenaspekt. Aber auch das ist noch nicht der Gipfel der Peinlichkeit.
Der besteht darin, dass eigentlich der Autor des Verrisses zusammen mit Michèle Binswanger ein Interview mit Schawinski eingeplant hatte. Nur: das durfte auf Weisung von ganz oben dann nicht erscheinen. So viel zur Unabhängigkeit der Redaktion. Der arme Arthur Rutishauser. Nicht nur degradiert zum SoZ-Chefredaktor; nicht mal hier darf er ungeniert schalten und walten.
Stattdessen verwendet Rico Bandle eine kurze Einleitung auf den Inhalt des Buchs, um dann den ganzen, langen Rest seines Artikels dem Nebenaspekt zu widmen, dass Schawinski beschreibt, wie er sich unglücklich im Verlag des Ehemanns von Roshani engagierte. Was eigentlich nur eine Fussnote im Recherchierstück ist.
Wenn man richtig bösartig sein wollte, und will man das nicht, kann man hinter dem Titel auch eine Spur Antisemitismus vermuten; geht es hier einem Juden wieder mal nur ums Geld?
Auch CH Media bekleckert sich nicht gerade mit Ruhm und Ehre. Hier ergreift Christian Mensch das Wort: «Lohnt sich die Lektüre?» Er beginnt mit einem Lob: «Roger Schawinski, der nächsten Monat seinen 78. Geburtstag feiert, hat es noch drauf.» Um es dann zu vergiften: «Bei so viel Reflex bleibt die Reflexion leicht auf der Strecke … voyeuristisch durchaus interessant … Möchte man Schawinski ehren, ist «Anuschka und Finn» das helvetische Gegenstück zu «Noch wach?», dem aktuellen Schlüsselroman von Benjamin von Stuckrad-Barre».
Das ist nun der Gipfel der Abgefeimtheit. Schawinskis Werk mit dem Schundroman eines eitlen PR-Genies in eigener Sache zu vergleichen, der selbstverliebt aus dem Nähkästchen plaudert und seine Zeit als Mietschreiber für Springer Revue passieren lässt, das ist unerträglich.
Dann wirft Mensch Schawinski doch tatsächlich vor, dass der im kleinen Schweizer Medienzirkus mit allen Protagonisten per du sei, schlimmer noch: «Zu einer ebenso kritischen Haltung gegenüber Canonica, der Tamedia sowie zu ihrem Verleger Supino kann sich Schawinski nicht durchringen. Verständlich, hat der Zürcher Medienkonzern doch 2001 für 80 Millionen Franken seine Radio- und TV-Sender gekauft.»
Beisshemmung wegen einer über 20 Jahre zurückliegenden Transaktion? Schwacher Angriff, ganz schwacher Angriff. Und noch ein letzter Tritt ans Schienbein: «Den Applaus dafür hat sich der Autor vorab gesichert. Auf dem Klappentext heisst es, das Buch sei ein «Thriller».»
Müsste man einen Klappentext für diese Beckmesserei schreiben, würde der lauten: neidvoller Konzernjournalismus, offenbar hat CH Media nicht verdaut, dass ihre eigene Schmierenberichterstattung über den Roshani-Skandal von Tamedia mit einer erfolgreichen Verfügung beantwortet wurde, dass CH Media sich öffentlich für Fehlberichterstattung über Tx-Boss Supino entschuldigen musste.
In der «Süddeutschen Zeitung» meldet sich deren Schweizer Korrespondentin Isabell Pfaff zu Wort. Sie zitiert zunächst das Landgericht Hamburg: «Laut dem Beschluss, der der SZ vorliegt, darf der Spiegel neun Passagen nicht länger verbreiten.»
Dann hebt auch Pfaff von der Realität ab: «Im Fall Magazin hat Schawinski schon früh Position bezogen.» Wie das? Er habe Auszüge aus dem internen Untersuchungsbericht veröffentlicht. Wie schon zuvor Tamedia selbst, und was soll daran ein Positionsbezug sein? Dann zitiert sie Schawinskis Schlussfolgerung, dass Roshani um jeden Preis die Stelle von Canonica wollte. Um fortzufahren: «An dieser Stelle muss man festhalten, dass sich die Wahrheit über das, was sich zwischen Roshani und Canonica abgespielt hat, vermutlich durch keinen Untersuchungsbericht, kein Gerichtsverfahren und keinen Zeitungsartikel aufdecken lassen wird.» Aber zumindest lässt sich wohl doch Wahrheit darüber herstellen, was an Roshanis Behauptungen wahr und was unwahr ist; darum geht es nämlich im Buch.
Zurück zu ihm, bekommt Schawinski nun sein Fett ab: «Der Tonfall von Schawinskis Buch wiederum kippt an vielen Stellen ins Frauenfeindliche und in pauschale Medienschelte.» Ins Frauenfeindliche? Unglaublich, dass auch in der SZ das Narrativ durchgeht, dass jede Kritik an weiblichem Verhalten gleich frauenfeindlich sei.
So kritisch sie sich mit ihm auseinandersetzt, so unkritisch gibt Pfaff dann ihren Primeur weiter; es ist ihr gelungen, Roshani am Telefon ein paar Worte zu entlocken: «„Ich habe Canonica in meinem Text nie mit Weinstein gleichgesetzt“, sagt sie». Was natürlich nicht stimmt, in der Einleitung ihrer «Spiegel»-Schmähschrift tut sie genau das. Genauso unkritisch lässt Pfaff die unverschämte Darstellung von Roshani stehen, ihr Versuch, Canonica aus dem Chefsessel zu kippen, «ihre Initiativbewerbung 2020 auf die Position der Chefin beim Magazin» sei «eine Art „Vorwärtsstrategie“ gewesen». Dass diese «Vorwärtsstrategie» von massivem Mobbing seitens Roshani begleitet wurde, kein Wort drüber.
Dann darf Roshani noch sagen: «Mit Schawinski habe sie nicht über den Fall sprechen wollen, weil sie sich von ihm in mehreren Radiosendungen nach Erscheinen des Spiegel-Artikels vorverurteilt fühlte». Sie wählt für ihre Aussagen lieber Pfaff, weil sie zu Recht von der keine kritischen Nachfragen befürchten muss.
Zusammenfassung: Die Medienreaktion auf Schawinskis Buch ist genauso ausgefallen, wie hier prognostiziert wurde. Entweder eisiges Schweigen – oder aber mehr oder minder bösartige Verrisse.
Wobei das dröhnende Schweigen zum eigenen Fehlverhalten, die völlige Unfähigkeit zur Selbstkritik, ja zur Selbstreflexion, an Peinlichkeit kaum zu überbieten ist.
Eigentlich wäre eine Fortsetzung angezeigt. Denn das, was Roshani und «Spiegel» – mitsamt der «Zeit» –vorgelegt haben, wird von der Berichterstattung in den übrigen Medien an Unfähigkeit und mangelnder Professionalität in den Schatten gestellt.