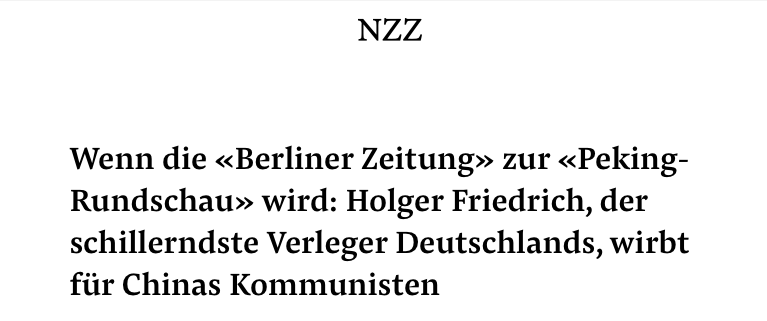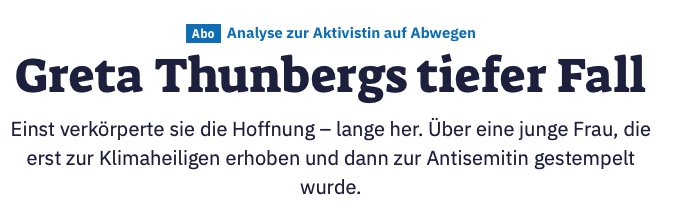dann brennen immer noch die Sicherungen durch.
Lucien Scherrer neigt dazu, die Splitter in den Augen der anderen, aber den Balken im eigenen, bzw. in seinem Blatt, nicht zu sehen. Aber gut, welcher Journalist lässt sich schon gerne an sein dummes Geschwätz von gestern erinnern.
Scherrer will sich ganz allgemein als Medienkritiker etablieren, und diesmal hat er sich ein eher fernes Blatt vorgenommen. Fern ist immer gut; da muss man weniger mit Gegendarstellungen und Vorkenntnissen der Leser rechnen.
Seinen Unmut hat diesmal die «Berliner Zeitung» erregt. Die hat nun eine schillernde Geschichte und einen ebenso schillernden Verleger. Holger Friedrich hat das Blatt nach x-fachem Besitzerwechsel im September 2019 gekauft. Er selbst ist ein Selfmade-Millionär mit kurviger Vergangenheit und kantigen Meinungen.
Darüber kann sich jeder sein eigenes Bild machen, wenn’s beliebt. Solche Differenzierungen sind Scherrer hingegen wurst. Er behauptet kühn:
«Im angeblichen Bemühen, unvoreingenommen zu berichten, machen sie sich zu nützlichen Idioten von Diktaturen.»
Also sei Friedrich ein nützlicher Idiot von Diktaturen, genauer von denen in Russland und China. Steile These. Sie ist ungefähr so absurd, wie wenn man die NZZ als nützlichen Idioten der US-Militärpolitik bezeichnen würde, nur weil ihr oberster Oberst, der kälteste aller kalten Krieger Georg Häsler, ständig staubtrockenen Unsinn aus dem militärischen Sandkasten auf seinem Kommandopult in der Redaktion schaufelt.
Nun hat Scherrers besonderen Unmut erweckt, dass Friedrich an einer Marxismus-Konferenz in Peking teilgenommen hat. So wie ständig Redaktoren der NZZ (und von anderen Blättern) an Konferenzen von liberalen, politischen, transatlantischen Think Tanks und Organisationen teilnehmen. Was erlaubt und nicht allzu selten interessant ist. Dass die NZZ keinen Korrespondenten an diese Konferenz in Peking entsandte, sei ihr nachgesehen.
Ob sie es sich allerdings nicht verbitten würde, wenn ihr Korrespondent (da gibt es auch Beispiele von NZZ-Herrenreitern) so charakterisiert würde? «Er (Friedrich, Red.) ist Millionär und fährt Ferrari, pflegt aber eine offene Bewunderung für Sarah Wagenknecht und den letzten DDR-Staatschef Egon Krenz.»
Der ehemalige Feuilletonchef der «Zeit» Fritz J. Raddatz war kein Millionär, fuhr aber Porsche und wurde ebenfalls in der DDR sozialisiert, was ihn für diese Position nicht disqualifizierte.
Nun kommt Scherrer kurz zu einer vergifteten Lobeshymne: «Seine Zeitung will Friedrich als Debattenblatt positionieren, sie soll auch Meinungen abbilden, die der «Mainstream» ignoriert. Eigentlich ist das ein interessantes Konzept.» Immerhin, aber: Er «will vermitteln, unterzeichnet «Friedensmanifeste» und betätigt sich als eine Art Diplomat, der an Botschaftsempfängen und Konferenzen teilnimmt. Deshalb erscheint er als Akteur in seiner eigenen Zeitung, oder er schreibt gleich selber über seine Erlebnisse.»
Friedrich hat, wie fast eine Million andere (auch ZACKBUM-Redaktor René Zeyer), das Friedensmanifest von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht unterzeichnet, was wohl sein gutes Recht ist. Ebenso wie die Teilnahme an Empfängen und Konferenzen.
Dann nimmt Scherrer den Knüppel hervor: «Auch wenn Friedrich Sympathien für Despoten wie Wladimir Putin abstreitet, publiziert seine Zeitung immer wieder Beiträge, in denen es mehr um Verdrehungen und Schönfärberei geht als um andere Sichtweisen.» Nun ja, in dieses Zerrbild Scherrers passt zum Beispiel dieser Artikel nicht: «Wladimir Putins Jahreskonferenz war eine sterbenslangweilige Märchenstunde». Aber auch Scherrer frönt dem dummen Prinzip: never let the truth spoil a good story.
Es geht noch schlimmer: «Im Fall China wird die Vermischung von Journalismus und Propaganda noch deutlicher. An der Konferenz der «modernen Marxisten» in Peking war Holger Friedrich als Gast vor Ort, laut einer Fussnote unter seinem Artikel in der «Berliner Zeitung» hielt er auch ein Referat.»
Um beurteilen zu können, wie Friedrich über diese Konferenz berichtet, müsste man seinen Artikel lesen können:

Der steht allerdings hinter der Bezahlschranke, wodurch Scherrer annimmt, dass keiner der Leser seiner Philippika überprüfen kann, ob seine billige Polemik etwas mit dem Inhalt zu tun hat oder nicht. Ihnen sei versichert: nicht.
Friedrich referiert sachlich und unaufgeregt über die Themen: «Die chinesische Administration hatte zu dieser außergewöhnlichen Konferenz geladen. Das Vorhaben bestand darin, über Stand und Ausblick sozialistischer Konzepte zu diskutieren. Veranstaltet und organisiert wurde die Tagung vom Institut für Marxistische Studien, dem Thinktank der Kommunistischen Partei Chinas. Vom 28. bis 30. November fanden sich in Peking 80 Vertreter aus 34 Ländern ein.»
Scherrer könnte nun vielleicht eine Zusammenfassung liefern, worüber dort debattiert wurde. Stattdessen bemängelt er lieber, worüber nicht gesprochen wurde: «Dass China Länder wie Taiwan und die Philippinen bedroht, war offenbar kein Thema, zumindest ist bei Holger Friedrich nichts darüber zu lesen.» Zudem fehlte eine kritische Würdigung des Uiguren-Konflikts.
Aber irgendwie verspürt Scherrer, dass er sich mit seiner Schmierendarstellung auf rutschigem Eis bewegt und ruft die Kollegen aus Deutschland zu Hilfe: «Der Beitrag hat in deutschen Medien für Häme gesorgt. Die «Frankfurter Allgemeine» ätzte über «Journalismus, wie er in China praktiziert wird» – und warf Friedrich vor, mit dem Regime zu sympathisieren. Ob dieser (Friedrich, Red.) bloss naiv ist oder ob er sich aus politischer Überzeugung instrumentalisieren lässt, bleibt offen. Sein an Parteizeitungen wie die «Peking Rundschau» erinnernder Bericht passt jedenfalls zu jenem «antiimperialistischen» Weltbild, das der ehemalige DDR-Bürger Friedrich wiederholt offenbart hat.»
Ehemaliger DDR-Bürger? Soll ihm mit diesem üblen Tritt in die Vergangenheit unterstellt werden, Friedrich trage immer noch die Wurzeln seiner sozialistischen Sozialisierung mit sich? Sei sozusagen geographisch kontaminiert? Und belegt eine Polemik der FAZ irgendwie die Richtigkeit der Polemik von Scherrer? «Die haben auch gesagt», wie tief kann einer sinken.
Nachdem sich Scherrer so übel wie oberflächlich an Friedrich abgearbeitet hat, kann er sich am Schluss einen Schlenker in die Nähe nicht verkneifen. Nach Friedrich muss natürlich noch der zweite Verleger hinhalten, dessen Haltung Scherrer überhaupt nicht passt. So werde «berechtigte Kritik an westlicher Machtpolitik» als Vorwand genommen, «um diktatorische Regime zu verteidigen. Zu sehen ist das im Magazin «Weltwoche», das wiederholt Putins Verbrechen relativiert und «Journalismus» im Sinne der KP Chinas betrieben hat. Ähnlich wie Holger Friedrich versucht der Verleger Roger Köppel solche Beiträge zu rechtfertigen, indem er betont, man müsse auch «andere Sichtweisen» zulassen».
Versucht zu rechtfertigen? Wieso versucht? Scherrer selbst hingegen hat das nicht nötig. Er antwortet erst mal gar nicht auf Anfragen von ZACKBUM, womit er natürlich seine überlegen-liberale Haltung zum Ausdruck bringt.
Die NZZ bleibt weiterhin ein Leuchtturm im deutschsprachigen Journalismus. Allerdings häufen sich doch die blinden Flecken auf der Linse. Qualitätskontrolle, Ausgewogenheit, der Versuch, auch abweichenden Meinungen oder Positionen wenigstens gerecht zu werden, andere Meinungen zuzulassen und kritisch zu würdigen – das ist Scherrers Sache nicht.
Die «Berliner Zeitung» hingegen hat eine Einrichtung, die auch der NZZ zur Ehre gereichen würde:

Der NZZ kann man hingegen nicht vorwerfen, dass sie deutlich abweichende Meinungen zu Wort kommen lassen würde. ZACKBUM kann dafür aus eigener Erfahrung Beispiele liefern.
Einbetoniert in Vorurteile und die unfehlbare eigene Meinung dummschwätzen, verbale Gesteinsbrocken aus der Schiessscharte des reinen Gesinnungsjournalismus werfen – was das mit intelligenter Wirklichkeitsbeschreibung zu tun haben soll? ZACKBUM muss sich wiederholen: NZZ, quo vadis?