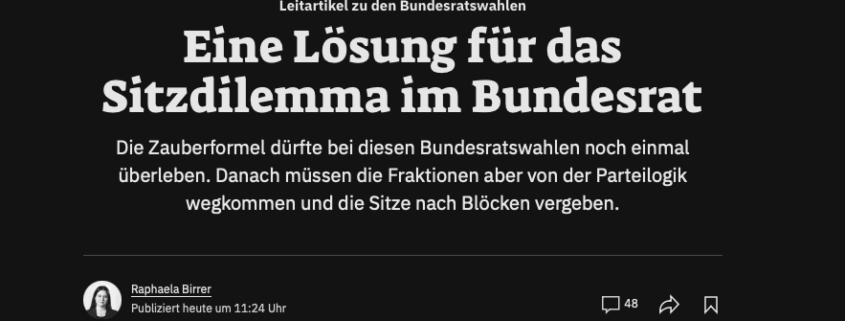Und der Gewinner ist …
… die «SonntagsZeitung». Dümmster Titel ever.
Headlines sind Zuspitzungen. Sie heissen auf Englisch auch noch «Barker», Beller. Sie sollen den Leser anbellen, damit er hinguckt und sich in den Artikel verbeisst. So weit, so gut.
Nun ist aber Chefökonom und Chefredaktor Arthur Rutishauser am Gerät, wie er mit seinem Editorial beweist. Dennoch lässt er einen solchen Titel durchgehen, mit dem jeder Anfänger aus dem Raum gelacht werden würde.
Armin Müller versucht sich im Text dann an einer Rettung: «Doch wenn die Teuerungsrate sinkt, heisst das nicht, dass die Preise sinken – sondern bloss, dass sie weniger schnell steigen.» Um den Wirrwarr zu vervollständigen, versucht er sich dann noch an einer originellen Definition des Unterschieds zwischen gefühlter und gemessener Inflation: «Dass die gefühlte Inflation nicht der gemessenen entspricht, liegt daran, dass die Teuerung längst nicht bei allen Löhnen ausgeglichen wurde.» Hä?
Vielleicht mal eine kurze Faktenbasis: nach offiziellen Zahlen stiegen die Konsumentenpreise im September in der Schweiz um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat; sie sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent. Sagt der Landesindex (LIK).
Die «gefühlten Preise» seien hingegen um 0,2 Prozent im Monatsvergleich angestiegen, aber daran ist die Konjunkturforschungsstelle der ETH beteiligt, deren Abkürzung KOF gerne mit doof assoziiert wird.
Das ist natürlich noch paradiesisch im Vergleich zur EU, wo Deutschland eine offizielle Inflation von 3,2 Prozent, Ungarn von knapp 10 Prozent ausweist.
Das Schlamassel hat mit der Messung der Inflationsrate zu tun, die mittels eines untauglichen Warenkorbs berechnet wird, in dem wichtige Preistreiber wie Versicherungsprämien oder Geldzinsen gar nicht enthalten sind. Es hat auch damit zu tun, dass diese Raten meistens im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen werden. Wurde damals vieles viel teurer, kann sie sinken, obwohl heuer vieles immer noch teurer wird. Vor allem natürlich Energie; Gas plus 77 Prozent, Heizöl 70, Strom 30 Prozent. So viel Solidarität mit der Ukraine muss halt sein.
Ganz allgemein sind in der Eurozone Güter des täglichen Bedarfs wie Nahrungsmittel ein sattes Viertel teurer geworden als im Vorjahr. Entsprechend mies ist die Stimmung der Konsumenten. Das nennt man nämlich Kaufkraftverlust; gekniffen sind weiterhin die Sparer, die inzwischen mageren Zinsen gleichen die Inflation nicht aus.
So viel zum Cover.

Lustig ist hingegen, dass Chefredaktor Rutishauser seiner Oberchefredaktorin Birrer widerspricht: Während die für eine völlig unrealistische Neuverteilung der sieben Sitze plädiert, will Rutishauser dem Leser eine Erhöhung auf 9 Bundesräte schmackhaft machen. Nochmal peinlich für Birrer: seine Argumentation hat Hand und Fuss und macht Sinn. Ob das allerdings seine Arbeitsplatzsicherheit erhöht? Denn auch im Journalismus gilt eine alte Indianerregel: der Häuptling singt immer am schönsten. So nebenbei: verdammte Machos, die edlen Indianer. Denn was ist die weibliche Form von Häuptling, he? How.
Trotz Nebenbemerkungen gegen diese verdammten Ränkespiele und öffentliche Geheimpläne beteiligt sich auch die SoZ daran. Indem sie dem absaufenden SP-Kandidaten Jon Pult im grossen Interview die Chance gibt, sich wählbarer zu machen. Kreidefressen in der Öffentlichkeit, kein schöner Anblick.
Keine spürbare Anhebung des Niveaus passiert dann auf Seite 5: Da «erklärt» ein Neuropsychologe (was es alles gibt), «wie Kinder am besten lernen können». Wie das? Nach, einfach: üben und wiederholen. Wie? Zurück zu Bleistift und Papier. Richtiger, aber völlig unrealistischer Ansatz, da zunächst einmal der ganze Schrott beiseite geräumt werden müsste, den die ewigen Schulreformen, aufgeführt von didaktischen Trockenschwimmern, hinterlassen haben.
Dann eine Hiobsbotschaft für alle Freunde der Alternativenergien: «Für die Solarkraftwerke wird die Zeit knapp». Das ist immerhin die Hälfte der Wahrheit, die andere ist: ihre Leistung wäre nie ausreichend, um die Stromlücke zu stopfen. Dafür (und für eine möglichst CO2-neutrale Energiegewinnung) braucht es AKW, braucht es sicher nicht den Ausstieg aus der Atomenergie. Wann sich das mal bis zur SoZ durchspricht?
Mehr schlechte Nachrichten, aber nur für Männer unter 50: schwere Herzerkrankungen mehren sich. Nun ja, im Rahmen des Konjunktiv-Journalismus, der aus einer Nullmeldung einen Barker machen will. Typisches Hochzwirbeln. «Gefährdet: Männer im besten Alter». Schweissausbruch bei diesen Männern, aber schon der Lead besänftigt. «Kardiologen sind besorgt, … zu schweren Herzkrankheiten führen können»; ach, wenn die Modalverben und der Konjunktiv nicht wären, was würde dann aus dieser Art von Journalismus?
Etwas ernster nehmen muss man den Indikativjournalismus von Michèle Binswanger: «Ärzte schlagen wegen Brustamputationen Alarm – und werden zensiert». Denn immer mehr Minderjährige, im Rahmen des Genderwahnsinns, meinen, im falschen Körper geboren zu sein – und wollen das operativ ändern. Ein Riesengeschäft.
Dann öffnet die SoZ eine Spalte dem deutschen Rechthaber Nicolas Richter von der «Süddeutschen Zeitung». Der weiss nämlich: «Es rächt sich, dass SPD, Grüne und FDP ihre Differenzen nicht gleich zu Beginn ausgeräumt haben.» Es ist immer ein Kreuz mit diesen Politikern, wieso hören sie nie auf sinnvolle Ratschläge von Menschen wie Richter? Die im Nachhinein immer vorher alles besser gewusst haben wollen.
Gibt es noch andere wichtige Probleme der Menschheit? Nun, eines, das vor allem Coleoiden umtreibt: «Darf man Tintenfische noch essen?» Die seien nämlich eigentlich zu intelligent dafür. Was ja Krake Paul bewies, indem er bei der Fussball-WM 2010 alle Spiele mit deutscher Beteiligung richtig vorhersagte. Was bei Schweinen aber kein Schwein interessiert.
Dann die Hiobsmeldung aus China: «8,5 Millionen in finanziellen Schwierigkeiten». Ist das das Ende des Reichs der Mitte? Moment, bei 1,4 Milliarden Einwohnern sind das 0,57 Prozent. Hm.
Dann widmet sich Aleksandra Kedves einem eher schlüpfrigen Thema. Die Generation Z verschiebe «ihr erstes Mal». Aber: «Dafür nehmen Masturbation und Pornografie-Konsum drastisch zu». Dabei weiss man doch, dass beides das Rückenmark schädigt und zu Hirnerweichung führt.
Apropos, die Farbe Weiss ist als Wohntrend schon wieder aschgraue Vergangenheit. Neu, weiss Marianne Kohler Nizamuddin, sind «flauschige Möbel» als «Teddys zum Wohnen» angesagt. Aber Vorsicht beim Ankauf: schon nächste Woche kann die kühle Sachlichkeit drohen.
Dann, das Absackerchen, widmet sich Sebastian Herrmann von der SZ endlich einer Frage, die auch ZACKBUM schon lange umtreibt: «Wieso verzapfen so schlaue Menschen bloss so blödes Zeug?» Endlich einmal die Art von Selbstkritik, die wir bei Journalisten so schmerzlich vermissen. Aber oh je, er handelt nicht etwa seine Kollegen von der Journaille ab, sondern Nobelpreisträger. Thema verfehlt, verschrieben, canceln.