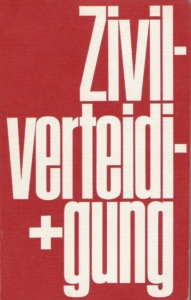Wumms: Marc Walder
Wird ihm seine Grossmannssucht zum Verhängnis?
Zwei Glatzköpfe vereint im Kampf gegen Corona. Alain Berset trat in der Grauenvoll-Zeitschrift «Interview by Ringier» als Modepuppe auf und zeigte sich Seite an Seite mit Walder bei der Vernissage des neuen Organs.
Walder reagierte hysterisch auf die Pandemie und liess sich doch tatsächlich dabei filmen, wie er stolz verkündete, dass er «seinen» Redaktionen die Stallorder ausgegeben habe, das Tun von Regierung und Ämtern nach Kräften zu unterstützen. Der damalige Oberchefredaktor der «Blick»-Familie musste auf der Frontseite in einem peinlichen «Statement» behaupten, dass seine Redaktionen selbstverständlich völlig unabhängig von Walders Meinung seien. Michael Ringier höchstpersönlich griff zur Feder und sprang seinem in die Bredouille geratenen Tennis- und Juniorpartner beiseite.
Kaum war das einigermassen abgewettert, wurde bekannt, dass Walder in einem regen Austausch mit Bersets Kommunikationschef Peter Lauener stand. Das hatte selbstverständlich keinerlei Zusammenhang damit, dass der «Blick» Anträgen aus Bersets Departement regelmässig medialen Schub gab, bevor der Bundesrat darüber beriet.
Währenddessen machte Berset mit privaten Kapriolen Schlagzeilen und leistete sich die Peinlichkeit, als Privatflieger von der französischen Luftwaffe zur Landung gezwungen zu werden, weil er sich in ein militärisches Sperrgebiet verfranzt hatte. Es muss grossartig gewesen sein, wie Berset den Franzosen zu erklären versuchte, dass er ein conseil fédéral der Schweiz sei. «Und ich bin der Papst», hat er sicher von einem Funktionär zur Antwort gekriegt.
Als Sündenbock in der ganzen Walder-Affäre musste bislang Lauener hinhalten; natürlich habe sein Chef nichts Genaueres von diesen Kontakten gewusst. Diese Verteidigungslinie liess sich aufrecht erhalten, solange SMS zwischen Berset und Walder geheim blieben. Walder berief sich dabei auf seinen Quellenschutz.
Aber der «Weltwoche» sind nun die Protokolle der Unterhaltungen zugespielt worden. Die wenigen veröffentlichten Beispiele zeigen, dass es einen engen Kontakt zwischen den beiden gab – und dass Walder aktiv versuchte, auf Entscheidungen des Bundesrats Einfluss zu nehmen: «So eine ganz klare Aussage wäre die kommende Woche wichtig», damit begleitete Walder einen Artikel der NYT, den er Berset ans Herz legte. Der antwortete brav: «Vielen Dank! Werde es lesen und schauen, was wir noch machen können.»
Dass mächtige Manager bei Regierenden ein und ausgehen, ist bekannt. Dass sie gefragt und ungefragt Empfehlungen geben, Forderungen aufstellen, in ihrem Sinne beeinflussen, nichts Neues. Aber dass ein führender Medienmanager dermassen ungeniert mitregieren will, das ist neu – und schockierend.
«Bersets Berater und Vertrauter», so nennt die «Weltwoche» Walder. Trifft das so zu, ist die Glaubwürdigkeit des Ringier-Organs «Blick» kontaminiert. Dass Walder operativ etwas in den Hintergrund verschoben wurde, ist reine Kosmetik, er ist weiterhin der designierte Nachfolger von Michael Ringier als Verwaltungsratspräsident.
Ausser, Walder fällt doch noch über sein übergrosses Bedürfnis, bei den Mächtigen und Wichtigen auf Augenhöhe zu sein. Männerfreundschaften mit Pierin Vincenz und Philippe Gaydoul resultierten daraus. Beide agierten eher glücklos als Geschäftsleute, um es mild auszudrücken. Dennoch hielten die Ringier-Organe Vincenz lange, zu lange die Stange und gaben ihm die Möglichkeit, Kritiken in Gefälligkeitsinterviews wegzubügeln.
Die Berset-Lauener-Walder-Connection ist inzwischen erstellt. Wie direkt nahm Walder Einfluss auf die «Blick»-Redaktion? Das bleibt solange im Dunkeln, bis weitere SMS oder E-Mails auftauchen. Denn auf eines kann man sich im elektronischen und digitalen Zeitalter verlassen: Kommunikation hinterlässt immer ihre Spuren. Früher hiess das «paper trail», heutzutage ist es viel perfider. Alles, was digital in die Welt gesetzt wurde, verschwindet nie mehr.
Nun muss sich Walder über die Feiertage eine Strategie überlegen, wie er diese neuerlichem Enthüllungen überstehen will. Wir sind gespannt.