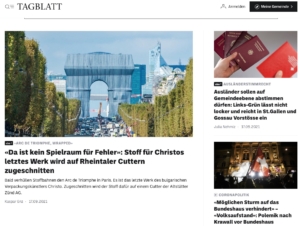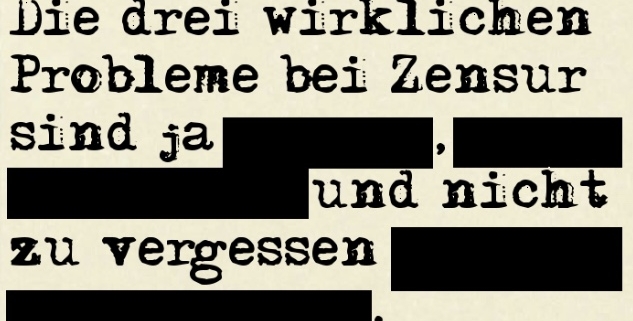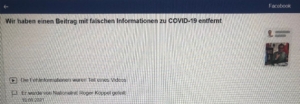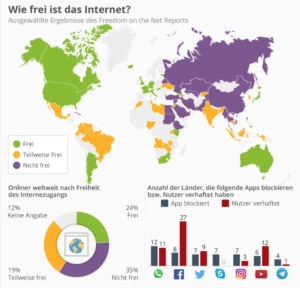Immer wenn man denkt: Dümmer geht nümmer, kommt der Beweis des Gegenteils um die Ecke.
Die Welt ist voller Probleme. Lebensbedrohlichen, herzzerreissenden, Gemüt und Seele marternden. All die Hungernden, Bedrohten, Unterdrückten, Ausgebeuteten, Niedergehaltenen.
Es ist so viel, dass es uns aus Selbstschutz wurst ist, ausser einigen Betroffenheitsheuchlern. Denken wir aktuell nur an eine ganze Generation von jungen Frauen in Afghanistan. Sie konnten rund 20 Jahre lang – nicht überall, aber doch – daran schnuppern, wie ein Leben aussehen könnte. Mit Bildung, Selbstbestimmung, Freiheit, aus seinem Leben machen zu dürfen, was man möchte. Endlich als Mensch mit Rechten respektiert zu werden.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Nun wird wieder das schwarze Leichentuch der Burka drübergestülpt, oder der Ausdruck freier Selbstbestimmung, wie Dummschwätzer von Daniel Binswanger abwärts schwafeln. Aber eigentlich ist auch das vom eigenen Bauchnabel zu weit entfernt, und das ist ja das einzige, was Schweizer Feministen interessiert.

Gleich schämen sich hier alle.
Besonders sensibel sind sie – das tut nicht weh und macht auch keine Mühe – bei sprachlichen Formen der männlichen Dominanz, des Sexismus, der Frauenverachtung. Das haben wir alles schon durch, und eigentlich meinte man: schlimmer geht nimmer. Um eines Schlechteren belehrt zu werden: schlimmer geht immer.
Denn es gibt ja noch «Das Magazin» von Tamedia, ein 32 Seiten umfassender Schatten seiner selbst. Das beweist mit seiner jüngsten Ausgabe, dass die Latte (Pardon) wirklich immer noch tiefer gelegt werden kann. Denn es macht uns auf ein Problem aufmerksam, unter dem vielleicht nicht die Frauen Afghanistans leiden, die den Taliban zum Opfer fallen. Auch nicht die Millionen von Frauen, die immer noch brutal der Klitorisbeschneidung zum Opfer fallen. Aber zumindest alle des Deutschen mächtige Frauen.
Ein Skandalwort muss weg, dann wird alles besser
Nur wussten es viele vielleicht noch gar nicht. Denn es gibt noch ein Skandalwort in der deutschen Sprache. Ein so schlimmes, abwertendes, frauenfeindliches, einfach übles Wort, dass das «Magazin» diesem Wort das Cover und die Titelgeschichte widmet. Genauer: der «Anregung für eine Umbenennung.» Denn das Wort muss weg.

Schämt euch eins!
Sogar ein Gutmensch und sensibler Mann in einem, also Bruno Ziauddin, gesteht im «Editorial», also in dem Schrumpfgefäss, das früher mal ein Editorial war: «Bis vor kurzem habe ich noch nie über das Wort *** nachgedacht, was bestimmt daran liegt, dass ich ein Mann bin. Das Wort bezeichnete für mich einfach einen Teil der weiblichen Geschlechtsorgane.»
«Bezeichnete», denn inzwischen ist Ziauddin geläutert und will es nie mehr verwenden. Dank des flammenden Appells der «freien Reporterin und Übersetzerin» Tugba Ayaz. Denn die stellt die Frage aller Fragen:
«Warum heissen Schamlippen Schamlippen?»
Was, Sie sagen nun: das ist ungefähr eine so intelligente Frage wie die, warum ein Tisch Tisch oder ein Glas Glas heisst? Vielleicht sagen sie auch: warum heisst es eigentlich DER Gewinn und DIE Pleite? Ist das nicht frauenverachtend genug?

Der Screenshot als Beweis: Wir erfinden nix.
Sie haben ja keine Ahnung. Schamlippen heissen so, weil Männer Schweine sind, so einfach ist das.
Daher lieber die Labien reinigen, von jetzt an
Oder wie das die Autorin mit dem handelsüblichen szenischen Einstieg bewältigt: ««Jetzt noch die Labien reinigen, und fertig sind wir!», sagte meine Schwester zu ihrer Tochter beim Wickeln.» Denn: «Das Mädchen sollte das Unwort «Schamlippen» gar nicht erst kennen lernen.»
Schon wieder ein Mädchen, das viel Geld für eine langwierige Psychotherapie ausgeben muss, um über einen solchen Wahnsinn hinwegzukommen, der ihm in unschuldig-kindlichen Jahren zugefügt wurde.
ZACKBUM versichert: Wir haben keine verbotenen Substanzen zu uns genommen, und das hier ist keine Satire. Bei der Autorin können wir das aber nicht garantieren:
«Warum heissen Schamlippen eigentlich Schamlippen? Inwiefern erzählen uns die Begriffe der Vulva – Schamlippen, Schamhügel, Schamhaare – eine Geschichte über das Schamgefühl?»
ZACKBUM gesteht: uns erzählen unsere Schamhaare keine Geschichten, aber wir sind ja – wie Ziauddin – männlich. Autorin Ayaz hingegen könnte nun einfach nachschlagen oder googeln, wieso das so ist. Weil sie aber prätentiös sein will, muss sie dafür die «Begründerin der feministischen Linguistik in Deutschland» konsultieren. Luise F. Pusch erklärt dann, was in jedem Lexikon steht: Scham und Schamgegend kommt vom lateinischen «pudendum».

Nein, meine Herren, das ist Kunst.
Weil sich christlich die Menschen für diese Körperteile schämen sollten, sind sie gerne mit Feigenblättern verhüllt. Alles trivial, banal, schnarchlangweilig. Aber wozu ist Pusch die Begründerin und eigentlich einzige Vertreterin der weiblichen Linguistik?
«Die Männer mussten sich nur noch bis zum Schamhaar schämen. Ihre anderen Schamteile heissen Penis und Hoden und nicht Schamstängel und Schambeutel»,
weiss Pusch. Das ist wahr, aber die anderen Schamteile bei Frauen heissen Vulva, Vagina, Klitoris, nix mit Scham. Und Hodensack oder Skrotum ist nun auch nicht so toll, ehrlich gesagt, da könnten wir uns mit Schambeutel durchaus anfreunden.
Keine Scherze mehr, es wird noch ernster
Aber Pusch hat bereits 1983 eine Glosse über «Scham und Schande» geschrieben, weiss Ayaz. Sie weiss aber nicht, dass auch der Sexualwissenschaftler Volkmar Siegusch in seinem Essay «Lippen der Scham» schon 2005 darauf hinwies, dass es keinesfalls egal sei, «ob wir von Schamlippen sprechen oder von Labien oder von Venuslippen». Wir wollen nicht rechthaberisch klingen, aber zudem gibt es ja wohl die kleinen und die grossen Schamlippen, nicht wahr?
Aber wir sind Männer, Pusch ist da schon weiter und möchte überhaupt auch den Begriff «Lippen» in diesem Zusammenhang vermeiden. Pusch wird zur Multilinguistin, leitet vom chinesischen «Gebärpalast» für Uterus «Pforten des Palasts» ab. Wem das chinesisch vorkommt, das «spanische vainilla bedeutet kleine Schote (vaina) und geht zurück auf das lateinische vagina. Wir könnten uns also auch Vanille für Wortkreationen nutzbar machen.» Vaina bedeutet allerdings in erster Linie Scheide, wie bei «Schwert in die Scheide stecken»; vielleicht doch nicht so toll.
Wenn man dann noch bedenkt, dass es wohl kaum ein Körperteil gibt (bei Männlein wie bei Weiblein), das mit dermassen vielen Bezeichnungen versehen ist, von Honigtöpfchen, Spältchen, Scheide bis hin zu Loch oder Fotze, der zweifelt verstärkt, ob es wirklich Sinn macht, in einem ganzen Sachbuch zu bemängeln, dass Begriffe wie «Vagina» oder «Scheide» einfach eine Körperöffnung bezeichnen, von den meisten aber «fälschlicherweise für das Genital» verwendet werden, warnt Ayaz und beruft sich auf die «Bestsellerautorin Mithu M. Sanyal», die nicht nur fordert, im Duden das Wort «Vulvalippen» als Ersatz einzutragen. Sie bemängelt auch, dass mit Vagina «das komplexe weibliche Geschlechtsorgan auf ein Loch reduziert» werde.
Falsche Wörter können verstümmeln!
Als ob das bei Schwanz oder Penis anders wäre, muss man doch den männlichen Standpunkt hier einbringen, aber der interessiert natürlich niemanden. Denn es ist ja mal wieder viel schlimmer, so zitiere Sanyal in ihrem «Vulva-Epilog» eine US-Feministin, für die «die falsche Benennung einer «psychischen genitalen Verstümmelung» gleichkomme».

Die Realität. Sie mit «falscher Nennung» zu vergleichen, ist bodenlos.
Fehlt da noch etwas? Ein Detail: «Die deutsche Sprache versteckt Frauen besser als eine Burka», schreibt Pusch und so zitiert sie Ayaz. Können wir diesen Wahnsinn zusammenfassen? Einen Teil des weiblichen Geschlechtsorgans Schamlippen zu nennen, das Ganze Scheide, das sei gleichschlimm wie eine Klitorisverstümmelung. Und die deutsche Sprache im Allgemeinen sei wie eine afghanische Burka.

Die Realität. Sie verbietet jeden ungehörigen Vergleich.
Wenn dass die Afghaninnen wüssten, die vor dem Regime der fundamentalistischen Wahnsinnigen dort nach Deutschland geflüchtet sind. Weil sie keine Burka tragen wollen. Nun müssen sie eine sprechen. Wenn das die Somalierinnen wüssten, die wie viele afrikanische Frauen nach Europa geflüchtet sind, um der barbarischen Klitorisbeschneidung zu entgehen – nur um hier «psychisch genital verstümmelt» zu werden.
Wir sind uns feministischen Wahnsinn in jeder Form inzwischen gewohnt. Aber wohl nicht einmal die Tagi-Frauen, die einen Beschwerdebrief über unerträglich sexistische Zustände auf den Redaktionen unterschrieben, würden so weit gehen. Hoffentlich.
Bar jeder Vernunft, jeder Relation, jedes Anstands
Nein, es ist nicht frauenfeindlich, wenn man dagegen stellen muss: diese Vergleiche sind fehl am Platz. Sie sind menschenverachtend. Sie sind widerlich. Sie zeugen von einer Haltung, die jegliche Massstäbe, jeden Anstand, jede Vernunft verloren hat.
Wer jeden Furz mit Zuständen wie im Dritten Reich vergleicht, ist ein Idiot. Wer Bezeichnungen oder Sprachgebrauch mit realer Klitorisbeschneidung oder dem Tragen einer Burka vergleicht, ist eine Idiotin.
Was soll man zu einem Organ sagen, das einen solchen Unsinn abdruckt? Vielleicht das: Wieso heisst «Das Magazin» eigentlich «Das Magazin»? Wieso heisst es nicht «Schämt Euch», Abfalleimer, Klosettschüssel, Brechmittel? Das sollte einmal linguistisch untersucht werden.