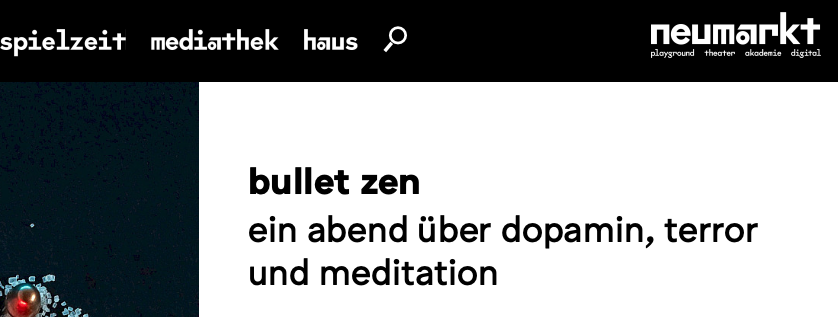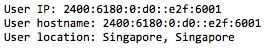Die Rote Fabrik fehlte noch
Desaster auf Desaster. Welch ein Trauerspiel.
«Republik», «Kosmos», «TagesWoche», «bajour», es scheint ein Gesetz der Serie zu geben. Denn nun reiht sich auch noch die Rote Fabrik in den bunten Reigen gescheiterter oder scheiternder linker Projekte ein.
Besonders peinlich war bislang der «Kosmos». Von grossmäuligen Erblinken ins Leben gerufen, fahrlässig gegen die Wand gefahren, der Steuerzahler darf aufräumen. Alle Beteiligten schoben sich gegenseitig die Schuld zu und jammerten über die eigene Befindlichkeit. Die über 70 auf einen Schlag arbeitslosen Angestellten gingen ihren ganz schwer an dem Körperteil vorbei, mit dem sie meistens denken.
Und jetzt das. 1980 erblickte das Kulturzentrum Rote Fabrik in Zürich das Licht der Welt. Nachdem es zu den Opernhauskrawallen gekommen war, weil dieser Kulturtempel mit 61 Millionen Steuergeldern alimentiert wurde, wollte das Bürgertum seine Ruhe haben und spendierte 2,3 Millionen Subventionen für dieses alternative Kulturzentrum.
Immerhin 42 Jahre lang ging das einigermassen gut, während in dieser Zeit doch alles in allem fast 100 Millionen Franken Steuergelder verbraten wurden. Neben dem Kulturzentrum gab es mehrere Tentakel, war alles furchtbar alternativ, und das Restaurant Ziegel au Lac blieb seiner Linie von Anfang an treu, mittelmässiges Essen und Trinken mit lausigem Service und steifen Preisen zu verbinden. Die Angestellten verstanden ihren Job immer schon mehr als Gesprächstherapie denn als Dienst am Kunden.
Nun ist aber plötzlich Feuer im Dach. «Zwei Wochen zuvor hatte der Vorstand erfahren, dass sich für das Jahr 2023 ein Defizit von einer halben Million Franken» auftue, schreibt der Tagi. Irgendwie kommt einem das seit dem «Kosmos» bekannt vor. Alles super, alles prima, eigentlich keine Probleme, und plötzlich macht es rums und die Bude ist fast pleite. Als wären die Verantwortlichen Banker, schwafeln sie dann plötzlich von Unvorhersehbarem.
Nun scheint aber der unfähige Vorstand von Mindereinnahmen, ungeplanten Mehrausgaben und vor allem «fehlendem Selfcontrolling bei der Personalplanung» überrascht worden zu sein. Offenbar liegt die Wurzel des Übels in einer turbulenten Mitgliederversammlung vom Sommer 2021, in der der alte Vorstand weggeputscht und durch sich spontan zur Verfügung stellende Nachwuchskräfte ersetzt wurde.
Offensichtlich haben die keine Ahnung von der banalen Tatsache, dass man nicht unbedingt mehr Geld ausgeben sollte, als man einnimmt. Oder vielleicht liessen sie sich von der «Republik» beraten, die macht das schliesslich auch so.
Nun ist auch noch das letzte langjährige Vorstandsmitglied zurückgetreten, und auf die Frage des Tagi, wie es denn zu diesem Schlamassel habe kommen können, wird die naseweise Antwort gegeben: «Die vielen unterschiedlichen Gründe für die aktuelle finanzielle Lage sind nachvollziehbar und belegt.»
Das ist Dummschwatz für: dem Vorstand war offensichtlich ein Budget, die Finanzierbarkeit von Stellen und ähnlicher bürgerlicher Kram schnurz. Nun müssen schlagartig fast 400’000 Franken bei den Angestellten gespart werden, es wird zu Entlassungen kommen. Die «Fabrikzeitung» wird eingestellt, das Programmangebot zusammengestrichen, also mit der Axt dreingeschlagen.
Wie es möglich ist, dass unbemerkt bei einem Gesamtbudget von knapp 3,5 Millionen Franken, von denen lediglich knapp eine Million selbst erwirtschaftet werden, plötzlich angeblich aus heiterem Himmel die Pleite droht – ein Abgrund von Verantwortungslosigkeit.
Man kann sich vorstellen, wie die Mitglieder der Gesinnungsblase in der Roten Fabrik schäumen würden, wenn ein bürgerlicher Betrieb aus heiterem Himmel verkündete, dass man gerade eben erfahren habe, dass man fast pleite sei und dringend Mitarbeiter rausschmeissen müsse, so als Weihnachtsgeschenk.
Das ist nicht lustig, das ist auch kein Anlass zur Häme. Aber es ist schon verblüffend, wie ein linkes Unternehmen nach dem anderen implodiert – und jedesmal ein fahrlässig-unfähiger Umgang mit eigenem und fremden Geld die Ursache dafür ist.
Natürlich ist die Steuersubvention der Roten Fabrik ein Klacks im Vergleich zur Kohle, die die Stadt ins Schauspielhaus und in die Oper steckt. Das ist aber kein Freipass dafür, schludrig und liederlich mit diesem Geld umzugehen. Und die Unfähigkeit des Vorstands müssen nun, wie üblich, die Angestellten ausbaden. Die sich Weihnachten auch ein wenig anders vorgestellt hatten.
Aber immerhin weiss man nun, wieso die Fabrik rot ist. Weil sie sich schämt, von solchen Pfeifen geleitet zu werden.