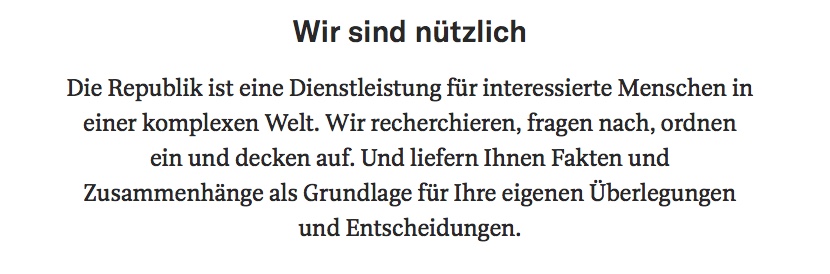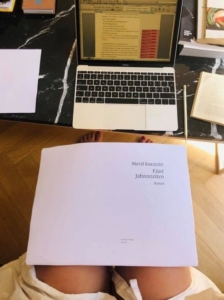Das Organ hat jeden Qualitätsanspruch verloren. Warum nur?
Von Stefan Millius*
Mit dem Zweiteiler über die angeblichen verschwörungstheoretischen «Infokrieger» innerhalb der Schweizer Medienlandschaft hat das Onlinemagazin «Republik» die Latte punkto journalistische Leistung kürzlich sehr tief gelegt. Mit einem Porträt über Jonas Projer, dem Chefredaktor der «NZZ am Sonntag», spazieren die Republikaner nun aber sogar noch bequem unter dieser Latte durch.
Das vorweg: Ich habe nie verstanden, warum der einstige «Arena»-Moderator Projer Chefredaktor der «NZZ am Sonntag» geworden ist. Nichts gegen interdisziplinäres Denken, aber eine Chefposition in einem der traditionsreichsten Zeitungsverlage, ohne je wirklich im Printbereich nennenswert tätig gewesen zu sein? Das ist im besten Fall mutig, im schlechtesten Fall einfach nur absurd.
Ich fand Projer nie speziell gut, und neben einigen durchschnittlichen Auftritten in der «Arena» sind mir auch einige besonders schlechte geblieben. Sprich: Ich bin weder befreundet noch verwandt noch verschwägert mit ihm und habe auch sonst keinen Grund, dem Mann die Stange zu halten.
Aber man soll jedem eine Chance geben, und nachdem ich nun kein besonders eifriger Leser dieses Sonntagsblatts bin, masse ich mir auch kein Urteil darüber an, wie gut oder schlecht Projer seinen Job erledigt. Abgesehen davon, dass es mir auch ein bisschen egal ist, er steht ja nicht auf meiner Lohnliste.
Bedeutungslose Begegnung
Die «Republik» hat dem Chefredaktor nun ein grosses Porträt gewidmet. Zugänglich nur für Abonnenten, aber wer eine kostenlose Proberunde machen will, bitte sehr, hier ist der Link.
Erstaunlicherweise versuchen es die Autoren für einmal mit einem völlig neuen Ansatz: Sie haben mit dem Mann sogar wirklich gesprochen. Die nationale Verschwörung rund um angebliche rechte Verschwörerjournalisten wurde dereinst ja weitgehend ohne Rücksprache mit den namentlich Aufgeführten bestritten. Es ist offen gesagt einigermassen frustrierend, wenn man wie ich offenbar eine der führenden Figuren der Verschwörungsbewegung ist und dann nicht einmal über die flache Erde, Reptiloide und Kinderquäl-Netzwerke im Innern von Bergen schwadronieren kann vor den Journalisten, die einen in diese Schublade stecken.
Die persönliche Begegnung nützte im Fall von Jonas Projer allerdings nichts. Denn noch bevor die Tür zur «NZZ am Sonntag» aufging, wussten die Leute von der «Republik» ganz offensichtlich bereits, dass der Gegenstand ihrer «Recherche» (selten habe ich so gerne Anführungszeichen gesetzt) total daneben ist und dass sie diesen Eindruck ihren Lesern unbedingt auch vermitteln wollen.
Noch einmal: Mich hat Projer bisher rein beruflich nie besonders beeindruckt. Was aber hier mit ihm geschieht, lässt einen staunend zurück. Und man freut sich als Aussenstehender, dass es wenigstens nur vor dem sehr überschaubaren Publikum der «Republik» passiert. Das ist in etwa, wie wenn ein Kegelclub in Bratislava schlecht über mich redet: Klar, schade, aber doch mit begrenzter Wirkung.
Anonymes Frustabladen
Jedenfalls: Projer wird regelrecht demontiert. Als unmöglicher Chef, als unmöglicher Mensch, als empathielos, als unfähig und so weiter. Offenbar hat der Mann in seinem bisherigen Berufsleben so gut wie nichts richtig gemacht. Deshalb wurde er wohl nach der SRF-Karriere auch zuerst von Ringier und dann von der NZZ abgeworben. Müssen alles Deppen sein dort, nicht?
Die Grundlage für diese Einschätzung für den Artikel? In erster Linie anonyme Beurteilungen einstiger Angestellten.
Was ist das wert? Ich habe als Medienkleinunternehmer in den letzten 20 Jahren alles in allem vermutlich etwa 30 Leute beschäftigt. Es wäre sicher kein Problem, darunter auch zwei oder drei zu finden, die ein vernichtendes Urteil über mich abgeben. Dabei geht immer vergessen, dass es erstens stets zwei Perspektiven gibt und zweitens in aller Regel eine Vorgeschichte, die man von aussen nicht kennt und die zu einem Zerrbild führen kann.
Wie genau sollen wir als Leser beurteilen, ob sich da nicht einfach ein frustrierter Ex-Angestellter mit eigenen Problemen völlig subjektiv den Ärger vom Leib geredet hat? Warum ist ein Max Mustermann, von dem wir nichts wissen, glaubwürdiger als der Protagonist des Stücks?
Er gendert nicht? Hilfe!
Das zweite Element der Demontage ist – ganz «Republik»-like – die eigene Einschätzung darüber, was richtig und was falsch ist. So sei Projer beispielsweise nicht besonders affin gegenüber Themen wie Woke und Gender, wie die Autoren sichtlich aufgebracht festhalten. Huch. Wie kann er nur!
Also, mal im Ernst: Nur weil aktuell die halbe Welt durchdreht und lieber heute als morgen die Biologie und die deutsche Sprache gleich auch noch abschaffen würde, muss ein Journalist das doch nicht mitmachen, um als edel und gut durchzugehen. Was bitte ist denn das für ein schräger Vorwurf? Ist es wirklich unzulässig, nicht auf jeden Zug aufzuspringen, der gerade durchfährt? Ich würde ja gerne bei dem ganzen Zirkus mitmachen, einfach um meine Ruhe zu haben, aber ich habe gar nicht genügend Fenster zuhause, um alle Fahnen aufzuhängen, die nötig wären für das politisch korrekte Bekenntnis – LGBTQ+, BLM, Greta-Starschnitt und so weiter.
Erstaunlich und ziemlich einzigartig ist es aber vor allem, auf wie viel Kritik das Porträt – das eigentlich einfach ein am Desk geplanter und dann in die gewünschte Richtung gedrehter Verriss ist – in der eigenen Community stösst. Die Kommentare der «Republik»-Leser zum Artikel sind grösstenteils negativ. Viele finden, Projer sei an sich doch gar kein nennenswertes Thema. Andere schreiben, sein Führungsstil sei das Problem des Unternehmens und nicht das der Öffentlichkeit. Eine dritte Gruppe hält das oben Beschriebene – die nicht mal ansatzweise verhüllte Voreingenommenheit – für problematisch.
Liebesentzug der Leserschaft
Jedenfalls sind viele der Abonnenten nicht glücklich mit der Leistung. Dazu muss man wissen: Bisher war die Beziehung zwischen Schreibern und Lesern der «Republik» eine unbefleckte Romanze, gegen die Bücher von Rosamunde Pilcher wie griechische Tragödien wirken. Alle haben sich gern, alle klopfen sich auf die Schultern, alle versichern sich gegenseitig, wie recht sie doch haben.
Und nun das: Ein Hauch von Kritik.
Und dieser unerwartete Liebesentzug kommt nicht gut an bei der Redaktion. Die «Republik» pflegt ihre Community im Kommentarbereich aktiv, was ich löblich finde. Im Regelfall. Einer der beiden Autoren des Projer-Artikels, und ich musste wirklich drei Mal hinschauen, ob ich das nun richtig gelesen habe, antwortete auf eine der Rückmeldungen so:

Also: Der Autor eines Porträts befindet öffentlich, der Gegenstand seines Artikels sei ein Mensch, den man meiden sollte. Na gut, immerhin ehrlich.
Ich bin nun wirklich kein Menschenfreund erster Güte und freue mich auch dann und wann, wenn ich bestimmten Gesellen aus dem Weg gehen kann. Aber öffentlich festhalten, jemand sei ganz allgemein zu meiden? Das ist harte Kost. Vor allem aus dem Mund beziehungsweise der Tastatur eines Journalisten, der gerade über diese Person geschrieben hat. Ich meine, ich müsste nun auch nicht unbedingt mit Karl Lauterbach in All-inclusive-Ferien verreisen, aber meinen Lesern empfehlen, den Mann grundsätzlich zu meiden? Das ist eine ganz andere Kategorie.
Journalisten als Antipathie-Vermittler
Oder sagen wir es frank und frei: Es ist widerlich. Aber gleichzeitig für uns Konsumenten überaus nützlich. Wenn man diese Zeilen des Herrn Albrecht gelesen hat, weiss man, wie ernst man sein Stück über Jonas Projer nehmen muss. Mit einem Rucksack voller Antipathie bei jemandem auftauchen, ihm vorgaukeln, man wolle mehr über ihn als Person erfahren, nur um ihn dann im Artikel so darzustellen, dass ihn möglichst auch jeder Leser nicht (mehr) leiden kann? Und dann noch im Dialog mit der Leserschaft schreiben, dass der Typ irgendwie total zum Speien ist?
Da scheint mir mein eigener Karma-Rucksack im Vergleich schon fast positiv gefüllt.
Ein bisschen Ursachenforschung. Wie verschiedene Quellen berichten, leidet die «Republik» derzeit unter einer Abwanderungswelle von bezahlenden Lesern. Wie gross und nachhaltig und existenzbedrohend diese ist, weiss ich nicht. Aber dass die Nerven allmählich etwas blank liegen, ist unübersehbar. Offensichtlich reagiert das Onlinemagazin auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, indem es inzwischen völlig unübersehbar all das Lügen straft, was es einst über sich selbst versprochen hat.
Denn die jüngsten Artikel, die mir begegnet sind, lassen nur ein Urteil zu: Billiger und unjournalistischer geht es nun wirklich nicht. Dagegen ist das Hausfrauenblatt «Die Frau von heute» ein Investigativmedium.
Hilflose Provokationsversuche
Früher war das Schlimmste, was man über die «Republik» sagen konnte, dass sie uns gerne auch mal die pure Irrelevanz in 70’000 und mehr Anschlägen serviert. Man musste regelrecht unbezahlte Ferien nehmen, um sich da durchzulesen. Natürlich wurde das Ganze obendrauf als objektive Stimme verkauft, war aber gleichzeitig unschwer erkennbar mit massivem Linksdrall ausgestattet. Doch das wiederum ist inzwischen so gewöhnlich, dass man es nicht mal mehr erwähnen muss.
Nun versucht die Zürcher Truppe offenbar etwas anderes: polarisieren, provozieren, auf die Trommel schlagen. Das aber, und in diesen Disziplinen fühle ich mich nun doch halbwegs zu einer Meinungsabgabe berufen, muss man auch erst einmal können. Selbst wenn die Botschaft der Provokation unterm Strich platt ist: Die Art und Weise, wie man sie serviert, darf es nicht sein. Nie. Jedenfalls nicht, wenn man angetreten ist, um den Journalismus neu zu erfinden, wie es die «Republik» seinerzeit getan hat. Man straft sich damit ja selbst Lügen.
Denn offen gesagt: Würde man das Projer-Porträt auf eine für den Durchschnitt verträgliche Länge eindampfen, hätte das auch auf «Watson» oder nau.ch stehen können. Direkt neben den Kätzchenvideos.
Das Problem, und offenbar ist das den verakademisierten Intelligenzbesten der Redaktion im Zürcher «Rothaus» selbst nicht bewusst: Sie haben sich von Anfang an ein Publikum geschaffen, das sich wie die Macher der Zeitung als etwas Besseres fühlen will. Ich weiss nicht, wie viele der knapp 30’000 Abonnenten jemals wirklich eines dieser täglich erscheinenden Textmonster zu Ende gelesen haben, aber darum ging es ja gar nie. Man wollte einfach am Abend bei einigen veganen Häppchen und der organisch produzierten Alternative zu einem Apérol Spritz dem Tischnachbarn verkünden, dass man «Republik»-Leser ist. Das ist doch so schön urban und weltoffen und man schläft danach besser.
Proleten statt Intellektuelle ansprechen
Aber nun macht das Magazin plötzlich munter Ausflüge in eine unappetitlich proletenhafte Ecke, zwar natürlich immer noch linksbewegt und damit mit der «richtigen» Haltung, aber inhaltlich so dünn wie die «Tierwelt» (pardon, falls sich diese in der Zwischenzeit gemacht haben sollte). Auch wenn die Autoren versuchen, das mit immer noch viel zu vielen Zeichen und mühsam konstruierten szenischen Zwischenspielen zu verschleiern. Ich könnte den Inhalt des «Infokrieger»-Zweiteiler und des Projer-Porträts problemlos auf fünf Zeilen zusammenfassen, mehr Gehalt war da nicht drin.
Nebenbei bemerkt: Das ganze Zeug liest sich nicht mal besonders schön. Und was das angeht, bin ich unerbittlich. Man kann mir auch puren Unsinn servieren, ich habe dennoch eine gute Zeit, wenn man mich wenigstens sprachlich verwöhnt.
Also gilt neuerdings bei der «Republik» ganz offensichtlich: Weg mit den hohen Ansprüchen und gnadenlos an die niederen Instinkte appellieren. Nur ist das eben nicht das, was die Abonnenten wollen. Die möchten sich suhlen in abgehobenen Ergüssen mit ganz vielen Zahlen und Querverweisen und Studien und Stimmen von moralisch aufgeladenen Experten, die kein Mensch kennt. Von all dem bleibt zwar am Ende des Textes jeweils nicht mehr viel übrig an Substanz, aber immerhin klingt es schlau.
Was die Abonnenten hingegen nicht wollen: mitverfolgen, wie Autoren ihre persönliche Antipathie gegenüber einer Person auf der Grundlage möglicherweise nicht mal existierender, aber sicher nicht qualifizierbarer Beurteilungen von Dritten bestätigen lassen und das als «Porträt» verkaufen.
Ungeliebte Führungsperson? Gähn.
Ich muss sagen: Nach dieser Lektüre ist mir Jonas Projer schon fast sympathisch. Der Mann hat sehr schnell Karriere gemacht, was ihm die sichtlich über den eigenen Werdegang frustrierten Autoren mehrfach im Text zum Vorwurf machen. Auf dieser Strecke hat er vermutlich nicht alles richtig gemacht, aber wer bitte tut das denn schon? Welche Führungsfigur wird von allen Untergebenen nur abgöttisch geliebt? Wer schafft sich keine Feinde auf dem Weg nach oben? Wer muss nicht mit Missgunst rechnen? Was ist neu daran?
Was diesen Artikel auszeichnet, ist lediglich, dass diese persönliche Missgunst Dritter, die man immer findet, endlich auf Journalisten trifft, die geradezu gieren nach negativen Feedbacks und sie noch so gerne kolportieren, weil sie der eigenen Einschätzung entsprechen. Das hat die «Republik» gemacht: Solange gesucht, bis jemand das sagte, was sie hören wollte. Und hat sich damit definitiv verabschiedet von den eigenen Ansprüchen.
Das passiert, wenn man nervös wird. Wenn man auf dem eingeschlagenen Weg ein paar Kratzer abkriegt und dann hektisch versucht, sich neu zu erfinden. In einer Disziplin, von der man keine Ahnung hat. Denn auch Demontage will gelernt sein.
PS: Dieser Text hat über 13’000 Zeichen und ist damit ein wahres Monstrum verglichen mit meinen sonstigen Beiträgen.. Das reicht aber bei Weitem noch nicht, um die Leute bei der «Republik» zu beeindrucken.
*Stefan Millius ist Chefredaktor «Die Ostschweiz». Dieser Text erscheint auf www.stefanmillius.ch. Zur stetigen Lektüre empfohlen.
![]()
![]()