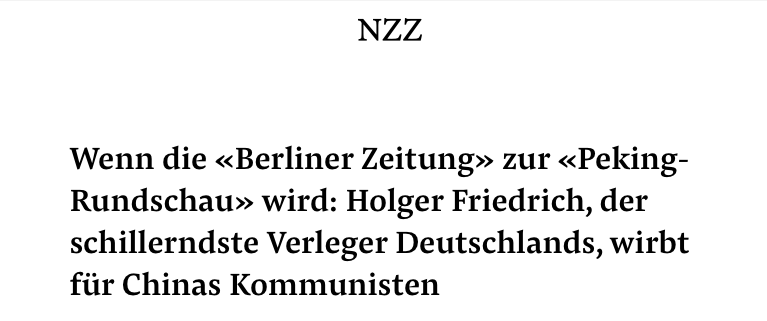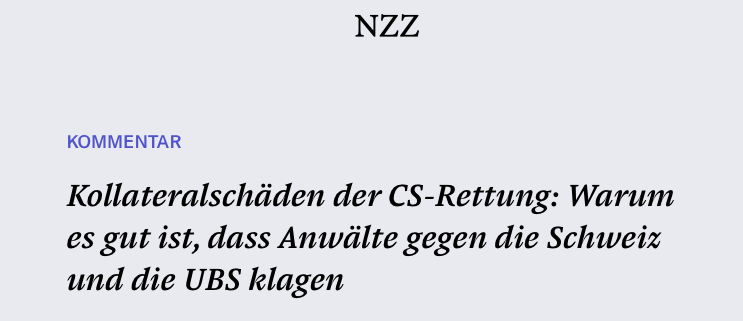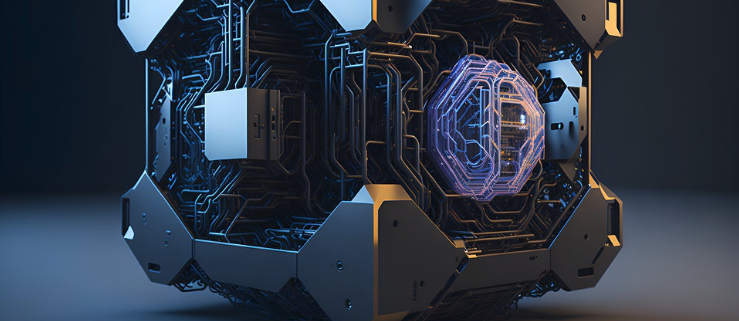Gurgel Gauck
Pastor, Bundespräsident, Kriegsgurgel. Was für eine Karriere.
Joachim Gauck möchte gerne das sein, was man in Deutschland eine «moralische Instanz» oder gar einen «elder Statesman» nennt. Dafür fehlt ihm aber das Format. Daher lässt es die NZZ mit ihm launig angehen. Sie eröffnet standesgemäss in einem Berliner Zwei-Sterne-Lokal ihre neue Gesprächsreihe «Zmittag».
Standesgemäss, denn Ex-Bundespräsident Gauck verursacht gigantische Kosten für den Steuerzahler («allein die jährlichen Personalkosten für Büroleiter, Referenten, Sekretärin und Chauffeur betragen 385.000 Euro», Wikipedia), plus Büroflucht und Altersruhegeld («Ehrensold» von 214’000 Euro, plus «Aufwandsgeld» von rund 80’000 Euro). Da dürfte ihn auch der Preis des Gourmet Menüs (6 Gänge 228 Euro) nicht abschrecken, oder aber er beschied sich mit drei Gängen des Mittagsmenüs (78 Euro).
Bei der Forelle zieht Gauck über die AfD, die SVP, die FPÖ und «Herrn Wilders in den Niederlanden» her. Differenzierung war noch nie so seine Sache. Es geht ihm überhaupt biblisch um «den Kampf gegen das Böse», also gegen Putin zum Beispiel. Kriegerisch war Gauck schon immer gestimmt, auch als es um den Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan ging.
Immerhin kommen hier seine Sottisen in lockeren Plauderton daher, unterbrochen von kulinarischen Ausflügen («Meine Buletten sind sehr, sehr gut», berlinerisch für Hacktäschli). Ganz anders bei der Qualitätszeitung Tamedia, Pardon, «Tages-Anzeiger», na ja, also dieses ungeliebte Anhängsel von Tx.
Hier geht er in die Vollen. Wieso haben «Rechtspopulisten Zulauf», fragen Dominik Eigenmann und Ausland-Chef Christof Münger im Chor und völlig unparteiisch. Eine Studie habe gezeigt, erwidert Gauck, «dass etwa ein Drittel der Menschen eine «autoritäre Disposition» hat». Aha, also eine hoffentlich heilbare Verhaltensauffälligkeit dieser rechtspopulistischen Wähler von AfD oder SVP.
Könnte die Migration eine Ursache dafür sein, soufflieren die beiden das nächste Stichwort. «Da werden Populisten Nutzniesser der Angst vor dem Verlust von Tradition, Sicherheit und Heimat – kurzum: von Vertrautem.» Ah, Angstmacher und Angstgewinner, dabei ist Migration doch eigentlich kein Problem. Aber immerhin ist Gauck nicht bei allen Parteien gleich scharf im Urteil, so bei der SVP: «Die ist für meinen Geschmack reaktionär, mag kein vereintes Europa oder will jedenfalls nicht dabei sein. Aber von ihr gehen keine nationalsozialistischen Gedankengänge aus wie bei einigen in der AfD.»
Richtig militant wird Gauck dann wie immer, wenn es um den Ukrainekrieg geht. Nicht nur viel mehr Waffen liefern sollte man: «Ja, im Grunde müssten wir dem überfallenen Opfer unsere Solidarität dadurch beweisen, dass wir selbst hingehen. Selbst mitzukämpfen wäre eigentlich das moralische, aber auch das politische Gebot.»
Aber um selbst mit gutem Vorbild und der Waffe in der Hand voranzugehen (oder würde er sie als Pastor nur segnen), davon hält Gauck dann doch ein «guter Grund» ab: «Einen Weltkrieg oder einen Atomkrieg wollen wir nicht.»
Gar nicht einverstanden ist Gauck allerdings mit der Einhaltung von Exportgesetzen durch die Schweiz: «Ich habe dafür null Verständnis. Ich habe schon Mühe, zu verstehen, warum die Schweiz mit der Europäischen Union so fremdelt.» Für den ehemaligen höchsten Repräsentanten der im Vergleich zur Schweiz doch eher jungen deutschen Demokratie zeigt Gauck dann bedenkliche Ansichten: «Bündnisfreiheit, das schon. Aber die Weitergabe von Waffen an die Ukraine zu untersagen, weil es dem Schweizer «Daseinsgefühl» widerspricht, halte ich für einen Fehler.» Das «Daseinsgefühl» der Schweiz, sich an ihre Gesetze zu halten (im Gegensatz zu Deutschland), das hält Gauck für einen Fehler? Spätestens da müsste es einem der beiden Interviewer einfallen, mal eine kritische Frage in die Schleimspur zu streuen. Aber i wo.
Stattdessen lassen sie Gauck weiter seine Kriegsfantasien ausleben: «Wird Russland in der Ukraine nicht entscheidend geschwächt, dürfte es seinen Feldzug Richtung Westen in einigen Jahren fortsetzen.» Kriegerische Bedrohung vom Iwan, diesmal überfällt nicht Deutschland oder Frankreich Russland, und wie steht es im Westen, in den USA, «wenn Trump zurückkehrt? – Dann wird es gefährlich für die amerikanische Demokratie.»
Was wünscht Gauck den Ukrainern zum Jahreswechsel? «Mögen sie sich lange wehren, hoffentlich mit deutscher und schweizerischer Unterstützung!» Natürlich sollte man vor einem 83-Jährigen Mann etwas Respekt und Nachsicht zeigen. Aber fast 20’000 A Interview ohne eine einzige kritische Nachfrage? Stattdessen liebedienerisches Stichwortgeben, soufflieren, Pseudofragen liefern, auf dass Gauck ungehemmt losschwadronieren kann? Soll das Qualitätsjournalismus sein? Oh, Pardon, das wäre ja schon eine kritische Frage gewesen – geht nicht bei Tamedia.