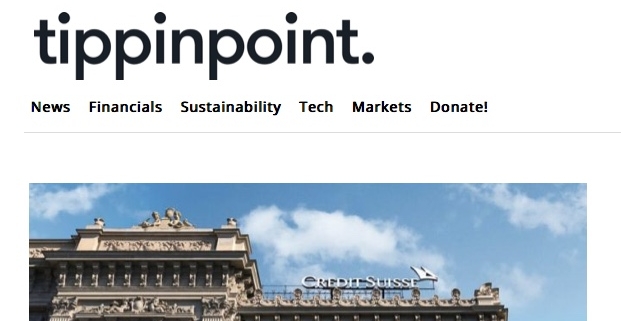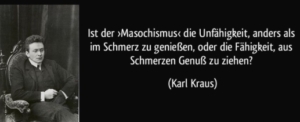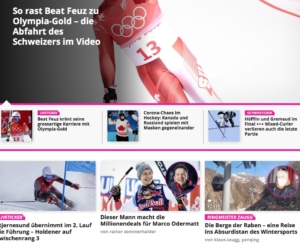Gerüchteküche «Republik»
Zwischen Tamedia und dem Online-Magazin herrscht schon länger bissiger Kriegszustand.
Die «Republik» versuchte, sich mit einer ihrer gefürchteten ellenlangen Fortsetzungsgeschichten an Tamedia abzuarbeiten. Sozusagen im Schrotschussverfahren. Dann verbrach Daniel Ryser ein Schmierenstück über eine angebliche «Zerstörungsmaschine», die über eine streitbare und hasserfüllte Kämpferin gegen Hass und Hetze hereingebrochen sei. Ein Schrottschussverfahren.
Er betrat dabei journalistisches Neuland für einen Recherchierjournalisten, in dem er zwar jede Menge Gerüchte kolportierte, aber allen namentlich genannten Protagonisten seines Artikels keine Gelegenheit zur Stellungnahme einräumte. Als ZACKBUM freundlich nachfragte, wieso und gleichzeitig fragend auf einen ganzen Stapel von Ungenauigkeiten, Schludrigkeiten und sogar Fake News hinwies, blieb Ryser stumm.
Nun köcheln gleich zwei «Republik»-Redaktoren ein Süppchen auf der Entlassung des «Tages-Anzeiger»-Redaktors Kevin Brühlmann. Steife These: «Aus politischen Gründen?» Fragezeichen sind immer gut, wenn man austeilen will, aber nicht sicher genug ist, das im Indikativ zu tun.

Während bisher davon ausgegangen wurde, dass es Brühlmann die Stelle kostete, weil er ein eher verunglücktes Porträt über eine Zürcher Stadtratskandidatin schrieb, behaupten Dennis Bühler und Carlos Hanimann: «Ein Zürcher Reporter fällt bei Verleger Pietro Supino in Ungnade und verliert seine Stelle. Die Redaktion reagiert mit einem geharnischten Protestbrief.»
Darin habe die Redaktion die Wiedereinstellung Brühlmanns gefordert und verlangt, dass auch die in der Hierrachie obendran stehenden Mitarbeiter, die den Artikel durchwinkten, sanktioniert werden müssten. Es seien immerhin fünf gewesen. Der Brief sei, man erinnert sich an einen anderen Protestbrief, von 71 Mitarbeitern unterzeichnet worden. «Der Wortlaut des Briefs ist der Republik bekannt.» Das ist eine sehr interessante Formulierung, weit entfernt von der Aussage: der Brief liegt der «Republik» vor.
Der Blitz Supinos habe eingeschlagen, vermutet die «Republik»
Obwohl laut «Republik» im Brief Beschwerde geführt werde, dass es nicht anginge, dass ein Redaktor wegen eines einzigen Fehlers entlassen werde, vermuten die Recherchierkünstler – ohne sich des Widerspruchs bewusst zu werden – dass Brühlmann schon letztes Jahr den «Groll von Verleger Supino auf sich gezogen» habe, als er einen Artikel über die Baugarten-Stiftung veröffentlichte.
Der sei von Co-Chefredaktor Mario Stäuble bestellt, für gut befunden und publiziert worden. Aber dann:
«Gemäss mehreren gut unterrichteten Quellen habe sich Stäuble nach der Publikation in einer Sitzung mit allen Chefredaktoren der Tamedia-Zeitungen und in Anwesenheit von Verleger Pietro Supino lange und ausführlich für die Recherche seines Reporters entschuldigt und für das eigene Versagen gegeisselt.»
Auch Brühlmann sei auf Intervention von Supino dazu gezwungen worden, sich bei Baugarten zu entschuldigen, will die «Republik» wissen. Nun ist es gerade bei ihr mit den «gut unterrichteten Quellen» so eine Sache. Die haben regelmässig ins Desaster geführt; Stichwort «Globe Garden», Stichwort «ETH» Stichwort weitere «Skandale» die auf solchen Quellen aufgebaut wurden – und kläglich verröchelten.

Hier kommt noch erschwerend hinzu: Der Artikel über die Stadtratskandidatin mit jüdischen Wurzeln ist tatsächlich teilweise verunglückt. Auf der anderen Seite hat die Porträtierte die Entschuldigung akzeptiert, den Fall für erledigt erklärt. Nur Katastrophen-Sacha ritt eine Attacke auf den «Stürmer von der Werdstrasse», mit der er sich selbst einmal mehr disqualifizierte.
Was Anlass zu Zorn geben könnte, ist nicht ersichtlich
Im Fall des Artikels über die Stiftung wird aber auch bei sorgfältiger Lektüre nicht klar, worüber sich da jemand hätte echauffieren können – und womit der Journalist den Groll Supinos auf sich gezogen haben könnte. Der Artikel ist sorgfältig recherchiert, scheint keine Fehlinformationen zu enthalten und erzählt, abgesehen von ein, zwei kleinen Schlenkern in die Vergangenheit des Stiftungspräsidenten als CEO von Holzim, faktenbasiert, unpolemisch die Geschichte einer der wohl bedeutendsten privaten Geldgeber Zürichs nach.
Es könnte vielleicht sein, dass sich Baugarten gewünscht hätte, nicht so öffentlich exponiert zu werden. Auf der anderen Seite ist es ja kein Geheimclub mit düsteren Aufnahmeritualen in dunklen Kellern. Im Gegenteil, sie verfügt sogar über eine eigene Webseite mit durchaus vorhandenen Informationen und Auskünften.
Schwacher Vorwurf, schweife in die Vergangenheit
Wenn der Hauptvorwurf nur sehr wolkig begründet werden kann, gehört es zu den ältesten Maschen, Parallelbeispiele aufzuzählen. Da fällt der «Republik» ein Artikel aus dem Jahr 2018 ein. Da drosch Philipp Loser unanständig, ohne die primitivsten journalistischen Benimmregeln einzuhalten und genauso unfundiert wie hier die «Republik», auf den Tamedia-Konkurrenten Hanspeter Lebrument ein.
Interessant war, dass auch dieses Schmierenstück durch alle hochgelobten «Qualitätskontrollen» durchrutschte. Dass es dann gelöscht wurde und Loser bei Lebrument zu Kreuze kriechen musste, war eigentlich selbstverständlich. Zudem überlebte Loser diesen Riesenflop. Leider.
Weiter ein von Supino der eigenen Redaktion gewährtes und dann zurückgezogenes Interview, eher ein Kuriosum und keine weitere Belegstelle für unziemliche Einmischung. Dass Supino tatsächlich stark intervenierte, um die gescheiterte Medienmilliarde zu unterstützen, das erwähnt die «Republik» lustigerweise nicht. Wohl weil sie auch dafür war.
Dann kommt noch die Uraltgeschichte der Entlassung von Chefredaktor Viktor Schlumpf anno 1991. Nach dieser sehr, sehr dünnen Suppe kommen die Autoren ohne jegliche Begründung zum Schluss:
«Der bissige Ton in Brühlmanns Text über die Baugarten-Stiftung wurde ihm zum Verhängnis.»
Wer in diesem Stück einen «bissigen Ton» entdeckt, hat wohl auch Angst vor einem Chihuahua, wenn der unter seinem rosa Mäschlein aus der Handtasche seiner Besitzerin kläfft.

Vorsicht, bissiger Ton.
Dass bei Tamedia bezüglich Qualitätskontrolle einiges im Argen liegt, ist offenkundig. Dass das auch bei der «Republik» der Fall ist, ebenfalls. Zudem vermisst man ein selbstkritisches Stück, wieso denn vom Chefredaktor abwärts weitere führende Redaktoren das Blatt verlassen. Wäre doch auch mal interessant zu wissen.