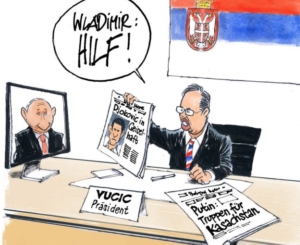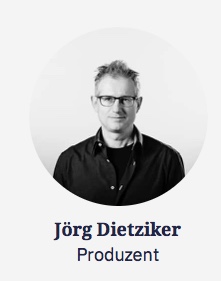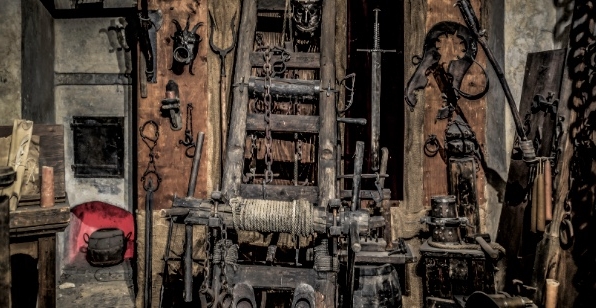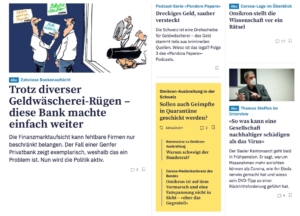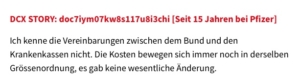Lustige Zustände bei Tamedia: Pelda berichtet, Dietziker beckmessert.
Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Kurt Pelda ist unbestritten einer der besten Reporter der Schweiz. Im Nahen Osten überall im Einsatz, unter Lebensgefahr und mit beeindruckenden Reportagen. Ein profunder Kenner der Gegend und des Fundamentalismus. Zurzeit noch für Tamedia.
Jörg Dietziker ist ein mittelmässiger Produzent, seit Urzeiten bei Tamedia am Schreibtisch sitzend. Dort entweder die Entlassung oder die Frühpensionierung erwartend.
Nun hat Pelda, wie immer gut dokumentiert, einen ausführlichen Artikel über das üble Zusammenspiel zwischen Seenotrettern im Mittelmeer und Schlepperbanden geschrieben. Das ist nicht das erste Mal, dass diese mehr als anrüchige Komplizenschaft thematisiert wird.

Zusammen mit seinem Kollegen Ayoub Al Madani hat Pelda wieder einmal genügend Belege zusammengetragen: «Das Mittelmeer ist zum Massengrab geworden für Menschen, die nach Europa migrieren wollen. Das hält manche Hilfsorganisationen aber nicht davon ab, mit Menschenhändlern zusammenzuarbeiten.»
Inhaltlich gibt es am Artikel nichts zu meckern. Das konstatiert auch Dietziker einleitend: «Der Text von Pelda beginnt faktengerecht.» Da ist der Journalist sicher froh, dass ihm der Sesselfurzer aus der Produktion das zubilligt.
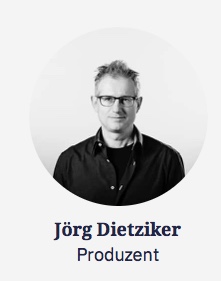
Geht mit dem Beckmesser auf die eigenen Leute los.
Aber das bleibt das letzte freundliche Wort von Dietziker. Von jetzt an haut er dem eigenen Tamedia-Mitarbeiter kräftig eins in die Fresse:
«Dann wird das Ganze zu einem unappetitlichen Mischmasch.»
Der Spezialist für Seenotrettungen Dietziker weiss nämlich: «Zudem ist die Verteufelung der Schlepper, auch wenn es darunter sehr zwielichtige Figuren hat, der falsche Ansatz.»
Dann kommt, so sicher wie der Furz nach dem Essen einer Zwiebel, der Nazivergleich. Denn Juden hätten schliesslich auch Schlepper geholfen, weiss Historiker Dietziker. Damit steht sein Urteil über «die EU, die Schweiz – und Herr Pelda» fest: alle drei «blenden in ihrer Geschichtsverleugnung solche Tatsachen gerne aus.»
Dann wird Dietziker noch ganz persönlich
Dieziker in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf; nun wird’s noch ganz schäbig und persönlich: «Der gute Herr Pelda füllt bald wieder die Lücke des schlechten (Philipp) Gut.» Das nennt man mal ein elegant gesetztes Bonmot. Aber Dietziker kann noch einen drauflegen: «Gut, der während seiner Zeit in Möppels Biotop der nützlichen Idioten mehrfach wegen übler Nachrede verurteilt wurde.»
Dass er nützlich sei, das hat Dietziker nun noch niemand vorgeworfen. ZACKBUM erinnert sich, dass der Produzent schon vor Jahren durch beklagenswerte Unfähigkeit auffiel. Aber deswegen wäre niemand auf die Idee gekommen, mit seinem Namen Schindluder zu treiben.
Hier erreicht der Wahnsinn im Hause Tamedia eine neue Qualität. Zumindest ist es ZACKBUM nicht bekannt, dass schon vorher einmal ein Produzent einem Reporter des eigenen Blatts dermassen und öffentlich über den Mund gefahren wäre.
Besonders putzig ist das Verwenden von völlig sachfremden Behauptungen, weil Dietziker immerhin intelligent genug ist, die Faktentreue und den Kenntnisstand von Pelda nicht anzuzweifeln.
Abmahnung oder gleich fristlose Entlassung?
Von all dem hat der Herr Produzent keine Ahnung, aber, wie es sich für das Haus Tamedia gehört, zu alldem eine Meinung. Die Verteufelung von Schleppern, die Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen haben, sei der falsche Ansatz, donnert Dietziker. Also ist der richtige, sie anzuhimmeln? Das wäre wohl das Gegenteil von verteufeln.
Als wäre das nicht schon schräg genug, wirft er dann gleich der EU, der Schweiz und natürlich auch «Herrn Pelda» vor, sie blendeten etwas aus, was gar nie Thema war, und das sei dann «Geschichtsverleugung».
Das müsste eigentlich schon für eine strenge Abmahnung reichen. Dass er in einem verunglückten Wortspiel mit Namen dann noch drauflegt, dass Gut «jetzt PR-Berater» sei und «nach wie vor jenseits von … na ja, Sie wissen schon … und böse – genau wie der gute Pelda», das sollte eigentlich für eine fristlose Entlassung reichen.
Der Gründe gäbe es genug
Zunächst einmal, weil man von einem Produzenten doch erwarten könnte, dass er nicht an der deutschen Rechtschreibung scheitert, dieser bösen. Dann, weil es doch wohl nicht angehen kann, dass ein Mitarbeiter einen anderen öffentlich dermassen anpinkelt.
Hätte es faktische Fehler zu bemängeln gegeben, wäre das wohl ein Thema für eine interne Auseinandersetzung gewesen. Wie Dietziker aber einräumt, gibt es die nicht. Sondern er ledert einfach über einen Kollegen ab, weil ihm die Aussage dessen Artikels nicht passt. Dagegen kann Dietziker zwar keine Argumente anführen, das versucht er aber durch Polemik, Häme und furchtbar verhauene Sprachscherze zu ersetzen.
Sollte Tamedia in irgend einer Form noch Wert darauf legen, ernst genommen zu werden, kann so eine Illoyalität nicht geduldet werden. Natürlich wäre auch eine öffentliche Entschuldigung fällig, wenn jemand in diesem Saftladen noch etwas Rückgrat zeigen will.
Als Philipp Loser im Auftrag seines Herrn einen Konkurrenten und dessen Verlag madig machte und sich dafür entschuldigen musste, war das immerhin ein Versuch, einen Mitbewerber runterzuschreiben. Aber einen Kollegen?
Man stelle sich nur vor, dass Dietziker auch beim Produzieren von Texten dermassen nassforsch seine unqualifizierte Meinung reinmecht. Da muss doch jeder Tamedia-Schreiber echt Schiss kriegen, dass sein Werk diesem aufgeblasenen Rechthaber in die Hände fällt.