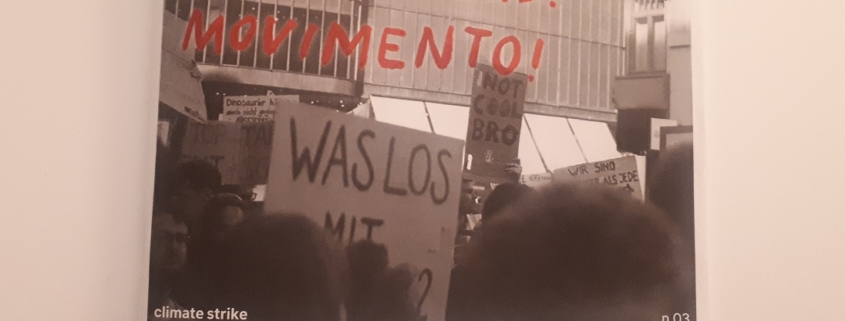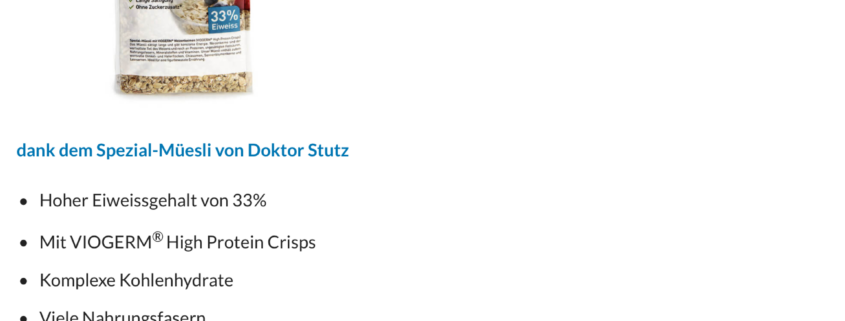Das Retro-Magazin der Klimaschützer
Wer sich unverstanden fühlt, wird selber Verleger.
Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten stellten im Frühling 2019 fest, dass ihre Forderungen zu wenig gehört und in den Medien nicht immer korrekt wiedergegeben würden. Eine Aussage, die bei bürgerlich eingestellten Zeitgenossen wohl Proteste auslöst hätte. Klimaaktivist Sam Lüthi sagte damals im Rahmen einer Diskussionsrunde, dass man wegen fehlender Resonanz zwei Projekte in den Startlöchern habe. Informationen selber herausgeben, allenfalls gar in einem eigenen Magazin und nicht mehr über, sondern mit den Leuten reden. Eine der Ideen haben die Klimaaktivisten mittlerweile umgesetzt. Ein eigenes Magazin. Es heisst «netto.null». Man kann es zum Beispiel im Orell Füssli kaufen, für fünf Franken. Die Ausgabe Nr. 3 ist 60 Seiten dick. Sie kommt von der Druckqualität ähnlich daher wie der ebenfalls aus der Alternativszene stammende «Zeitpunkt».
Auffallend ist, dass die Klimajugend auf den klassischen Print setzt, der ja oft angeprangert wird als Waldvernichter. Immerhin ist das Magazin CO2-neutral gedruckt. Und ab etwa vier bis fünf Lesern pro Ausgabe schneidet Papier energetisch sowieso nicht schlechter ab als Texte, die online gelesen werden.
Der erste Eindruck zur grafischen Umsetzung: wie ein gut gemeinter staatlicher Umweltbericht von 1999 auf Word-Gestaltungs-Niveau. Aber schliesslich zählt der Inhalt.
Und natürlich sorgt die politisch ziemlich korrekte und im ganzen Heft durchgezogene Dreisprachigkeit Deutsch/Französisch/Italienisch für eine gewisse Schwerfälligkeit.
Und wie ist der Inhalt?
Auf drei Seiten wird die GLP angeprangert, dass sie sich für grünen Kapitalismus einsetze. Etwas, was laut der 26-jährigen Autorin Rahel Ganarin unmöglich ist. «Denn solange wir uns selbst paralysieren mit dem Fetisch der Horizontalität, welche alle Meinungen berücksichtigen will, ohne sie kritisch zu beleuchten, finden wir keine radikale Antwort auf die Klimakrise», schreibt sie im Schlusssatz.
Anja Gada (18) und Flurin Tippmann (19) gehen der Frage nach, warum die Occupy-Bewegung nicht erfolgreicher war. Und stellen fest, dass auch der Klimastreik an einem kritischen Punkt angelangt ist. Selbstkritisch und hinterfragend, das ist positiv.
Ebenso positiv ist die Bildstrecke von Klimademos. Wenn darauf jemand eine Maske trägt, dann nur, damit man ihn auf Überwachungskameras nicht erkennen kann. Das waren noch Zeiten.
Auch einen A3-grossen Poster findet man im Heft. Komischerweise erinnert er an leicht vergilbte Flyer von 1999 oder sogar von 1980. Aber damals ging’s der Natur wegen Russ, Staub und Schwefeldioxyd auch wirklich dreckig. Dafür war der Klimawandel noch kein Thema.
Jonas Kampus fragt sich, was wäre, wenn rechtsextreme Parteien die Existenz der Klimakrise akzeptieren würden. Umweltschutz als Machtinstrument, um die Kontrolle über Menschen zu erlangen? Ein Argument, das heute eher den Linken vorgeworfen wird.
Und endlich wird’s konkreter! Ziemlich weit hinten kommen eine Agenda und konkrete Forderungen, etwa minus 13 Prozent Treibhausgasemissionen bis 31.12.2020.
Die Klassiker Autos, Flugzeuge, Beton und Heizungen als Klimakiller werden im Heft als Sündenböcke praktisch nicht angeschnitten. Das ist erfrischend, aber auch wieder erschreckend nahe an der GLP.
Vorbildlich sind die Quellenangaben zu den einzelnen Artikeln. Man merkt, dass nicht wenige Autoren einen wissenschaftlichen Hintergrund haben.
Zusammenfassend: kein schlechtes Heft und ein Lob an die Macher, dass sie 2020 auf Print setzen. Aber neue Anhänger wird die Klimabewegung dadurch wohl nicht gewinnen. Oft zu langfädig, zu wenig attraktiv aufgemacht, zu wenig konkret. Fairerweise muss man aber anfügen: es ist von jungen Menschen gemacht. Da muss (noch) nicht alles perfekt sein. Und: Einen Nutzen hat das Magazin aber alleweil. Es schweisst zusammen, macht der Bewegung sicher Freude. Und das ist fast bei jedem solchen Heft der Fall. In der Schweizerischen Gewerbezeitung steht eigentlich auch nur, was die Mitglieder eh schon wissen. Oder zumindest das, wofür die Mitglieder stehen.
P.S. der Magazin-Titel netto.null wird nirgends erklärt. Als Klimaschützer weiss man das offensichtlich. Für alle anderen hier die Erklärung: Netto-Null bedeutet, dass alle durch Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen durch Reduktionsmassnahmen wieder aus der Atmosphäre entfernt werden müssen und somit die Klimabilanz der Erde netto, also nach den Abzügen durch natürliche und künstliche Senken, null beträgt. (Quelle: Wikipedia)