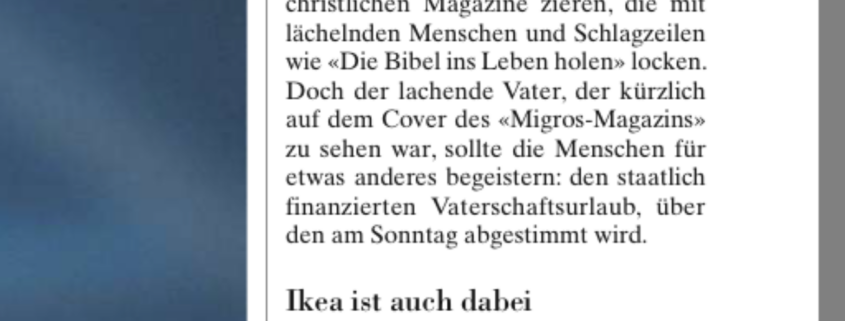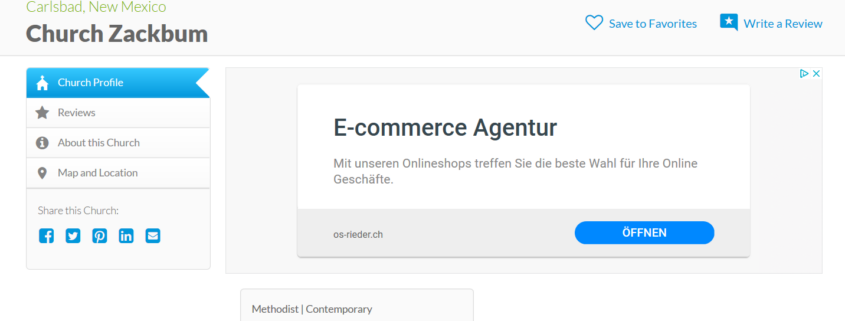«Z»: Die Vakanz des Stils
Das Format stimmt. Der Inhalt weniger.
Auch an «Z – die Substanz des Stils» aus dem Hause NZZ ist das Elend nicht spurlos vorbeigegangen. Hoffnungsfroh 10 Ausgaben, aktuell 9, da dürfte dann der Schritt zu zweimonatlich nicht mehr weit sein.
Aber es ist September, nach dem garstigen Frühling, dem auch nicht viel besseren Sommer sollten wir doch langsam wieder in Champagnerlaune und in Kaufräusche kommen. Schliesslich gehören wir Leser von «Z» zu einer «intelligenten und konsumfreudigen Leserschaft».
Bei diesem Format und dieser Leserschaft sind doch rund 30’000 Franken pro Seite gut angelegtes Geld für den Werbetreibenden. Das freut auch den Leser, denn die Doppelseite Rolex, die Doppelseite Van Cleef & Arpels kommen recht schmuck daher.
Zeitgeist muss nicht unbedingt aktuell sein
Apropos, geniale Überleitung, auf Seite 7 mit dem etwas ranschmeisserischen Titel «Fette Kette» macht nur ein ganz dezentes «Bucherer» zuunterst auf der Seite den intelligenten Leser darauf aufmerksam, dass die Redaktion vielleicht nicht nur aus Gründen des Stils ausgerechnet eine Bucherer-Goldkette ins Bild setzte.
Aber gut, man muss ja von was leben. Unter dem etwas angeberischen Titel «Zeitgeist» folgt dann die übliche Doppelseite mit Konsumtipps. Mit allzu brandheissen Neuigkeiten will «Z» hier den Leser nicht überfordern. Dass Spitzenkoch Stefan Heilemann seine Wirkungsstätte in den Zürcher Widder verlegt hat, ist allen Gourmets seit Juni dieses Jahres bekannt.
Dass Audemars Piguet sich einen spiralförmigen Neubau mit Museum geleistet hat, ist altbekannt. Dass das Museum nur nach Voranmeldung zu besichtigen ist, wäre vielleicht für alle spontanentschlossenen Leser einen Hinweis wert gewesen. Wir sind uns aber sicher, dass dieser Tipp nichts, aber überhaupt nichts mit dem doppelseitigen Inserat von Audemars Piguet in der Heftmitte zu tun hat.
Die Modestrecke als Tiefpunkt im Höhepunkt
Jetzt freuen wir uns auf den Höhepunkt des Hefts, die achtseitige Fotostrecke «Mann im Anzug». Da wurde nicht gespart; Fotograf, Styling, Assistenz, Casting, Wahnsinn. Und viel, viel Kunst, denn das Kleinfoto unter diesem Titel ist eigentlich das einzige in der ganzen Strecke, auf dem mehr als abgefilterte Umrisse, Ausschnitte, sozusagen Hingehuschtes, Verwedeltes zu sehen ist.
Der Tiefpunkt im Höhepunkt ist eine Doppelseite, auf der man einen nadelgestreiften Mantel, ebensolche Hosen und eine «Herrentasche mit Fransen» erahnen kann. Immerhin, die Kalbslederboots sind gut sichtbar. Wer hier aber die angepriesene Uhr oder das Hemd erkennen will, muss über hellseherische Fähigkeiten verfügen.
Das gilt auch für die Preise, die sind nämlich nur «auf Anfrage» erhältlich. Vollends zur Lachnummer wird diese Modestrecke, weil sie unter dem Motto stehen soll: «Strassentauglich. Unangestrengte Eleganz». Was allerdings an einem sattroten Doppelreiher mit sattrotem Pullover strassentauglich oder unangestrengt sein soll, verschliesst sich dem Betrachter, genau wie der Hinweis auf einen Ring von Cartier, den das Modell unangestrengt trägt, was aber leider aus mehreren Metern Distanz so wenig zu erkennen ist wie ein Hemd aus Schurwolle, bei dem man für schlappe 710 Franken vielleicht etwas mehr als die Manschetten sehen möchte.
Kein Unfall in der Druckvorstufe, sondern schlimmer
Dass hier kein Unfall in der Druckvorstufe passierte, beweist das letzte Foto. Wieso sich das Modell einen in Frischhaltefolie verpackten Wassermelonenschnitz vors Gesicht halten muss, erschliesst sich wohl nur stilsicheren Betrachtern, aber immerhin, hier ist die Cartier-Uhr tatsächlich knackscharf fotografiert, ebenso ein Ärmel eines Cashmere-Mantels. Ob man sich dazu das Hemd aus Baumwollpopeline für 460 Franken leisten möchte, ist auch hier schwer zu beurteilen, da der Arm, der die Melone hält, die Sicht aufs Hemd versperrt.
Auf drei Seiten Rimini als Destination vorzuschlagen, das zeugt, nun ja, von einer stilsicheren Unabhängigkeit von Jahreszeiten und Risikogebieten. Vorher noch nimmt man verwundert zur Kenntnis, dass immerhin 18 Nasen hinter diesen 48 Seiten stecken, verstärkt noch um 7 Autoren, denn man kann nun wirklich nicht alles selber schreiben.
Immerhin ein mehrfach versöhnliches Ende
Aber es gibt doch ein versöhnliches Ende. Nämlich ein grossartiges Zitat des legendären italienischen Regisseurs Sergio Leone über seinen Hauptdarsteller Clint Eastwood. Die Männerfreundschaft zerbrach dann an einem der zwei ewigen Gründe: am Geld. Daher rief ihm Leone nach: «Clint Eastwood hatte genau zwei Gesichtsausdrücke: einen mit Hut, und einen ohne.»
Ach, und auf der hinteren Umschlagseite zeigt doch tatsächlich Dior, dass man Schuhe, Hosen, eine Bluse, eine Handtasche, Schmuck, Kopftuch und eine Jacke so fotografieren kann, dass man etwas erkennt. Aber gut, dafür ist es natürlich kein substanzieller Stil.