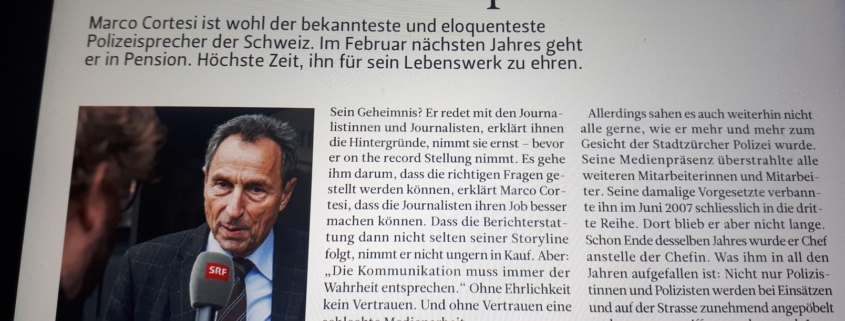Wie parteiisch ist die NYT?
Sie gilt als Benchmark für Qualitätsjournalismus. Zu Recht?
Ihr Redaktionsgebäude in New York ist beeindruckend. Ihre Journalisten sind beeindruckend. Die «New York Times» gilt als der selten bis nie erreichte Massstab für Qualitätsjournalismus.
Gegen den Output ihrer mehr als 1000 Journalisten verzwergt alles, was auf Deutsch erscheint. Für Schweizer Medien bräuchte man eine Lupe, wollte man sie vergleichen. Stimmt das so, ist das so?
Aus der Schweiz heraus ist es schwierig, die Positionen der NYT in den harten Auseinandersetzungen innerhalb der USA zu beurteilen, in der aufgeheizten Atmosphäre der nahe bevorstehenden Wahlen für das mächtigste Amt der Welt.
Wenn die NYT über die Schweiz schreibt, kann man ihre Qualität beurteilen
Aber wenn sich die grosse NYT um ein Thema aus der kleinen Schweiz kümmert, dann ist es eine gute Gelegenheit, die Qualität von Recherche, Faktentreue und unverfälschter Wiedergabe der Ereignisse zu beurteilen.
Vor allem, wenn es sich nicht um eine kleine Meldung über die kleine Schweiz handelt, sondern um ein Gewaltsstück mit 3211 Wörten, wie das im angelsächsischen Journalismus gemessen wird. Oder rund 20’000 Zeichen über einen einzelnen Menschen. Das Thema ist: «Die kurze Amtszeit und der plötzliche Sturz des einzigen schwarzen CEO».
Man kann dem Lead nicht vorwerfen, dass er den Inhalt des folgenden Artikels nicht akkurat zusammenfasse: «Tidjane Thiam machte die Credit Suisse wieder profitabel. Aber die Schweizer lehnten ihn als Aussenseiter ab, und ein jäher Skandal fällte ihn.»

Die NYT pflegt, wie ihr Abschreiber «Der Spiegel», den szenischen Einstieg in ein längeres Stück. Hier ist es eine Geburtstagsparty des VR-Präsidenten der Credit Suisse. Sie fand in einem Zürcher Lokal statt, es gab Showeinlagen, darunter die eines «Abwarts», der den Boden aufwischte und dazu tanzte.
Thiam und seine Tischbegleitung verliessen den Raum; es war ein Schwarzer, der den Abwart spielte. Als sie wieder zurückkehrten, sahen sie eine «Gruppe von Rohners Freunden» auf der Bühne, die eine eigene Nummer zum Besten gaben – alle mit Afro-Perücken.
Einstieg, Verallgemeinerung, Rückblende
Nach dem szenischen Einstieg muss die Verallgemeinerung kommen: Gespräche mit insgesamt 16 – anonymen – Quellen, nahen Mitarbeitern, Kunden, Freunden und Investoren, hätten ergeben, dass «race», also seine Hautfarbe und Herkunft, ein immer präsenter Faktor während seiner Amtszeit war, und dieser Rassismus «half, die Bedingungen für seinen erstaunlich schnellen Abgang zu schaffen».
Nach der Verallgemeinerung kommt die Rückblende; die Biographie Thiams von Geburt an. Bis hin zur Übernahme der Geschäftsleitung der CS, obwohl er dem um ihn werbenden Rohner «zweimal nein gesagt» habe.
Dann sein erfolgreiches Wirken, obwohl Zürich, die Schweiz ihm immer zu verstehen gegeben habe, dass er «nicht dazugehört», schliesslich die Auseinandersetzung mit seinem Private Banking Star, der Überwachungsskandal, der Abgang, obwohl er selbst nicht in die Affäre verwickelt gewesen sei.
Auch die Tränendrüse darf nicht fehlen
Trotz der Unterstützung grosser Aktionäre der CS, darunter David Herro von Harris Associates, die ihm öffentlich zur Seite sprangen, trat Thiam dann am 7. Februar zurück. Bei seiner letzten Medienkonferenz habe Thiam auf die Frage, ob seine Tätigkeit in England anders gesehen worden wäre, geantwortet «ich bin, wer ich bin», und jemand, der in seiner Nähe sass, will beobachtet haben, wie es in Thiams Augen verdächtig glitzerte.
Bevor wir uns die Tränen abwischen können, erzählt die NYT noch, wie Thiam in Zürich bleiben musste, um von der Bankenaufsicht FINMA einvernommen zu werden. Dabei wollte er dringend nach Los Angeles fliegen, wo sein Sohn mit nur 24 Jahren im Sterben lag, Krebs.
Schlusspunch und weiteres Wirken
Richtig, es fehlt noch der Schlusspunch, den setzt das Zitat einer Schwester von Thiam; sie fragt, ob die Schweizer wohl die Redlichkeit besässen einzugestehen, einen Schwarzen als Chef einer ihrer prestigeträchtigsten Firmen zu sehen, für sie «unerträglich» war.
Fehlt noch etwas? Natürlich; Thiam kämpft heute als Gesandter der Afrikanischen Union gegen die Pandemie in Afrika. Und andere Bankchefs kamen mit viel grösseren Fehlern davon, so der CEO von Barclays, der einen Whistleblower unter Einsatz der internen Sicherheitskräfte enttarnen wollte. Der bekam eine Busse und blieb im Amt. Natürlich ein Weisser, ebenso wie Jamie Dimon, der bei JPMorgan Chase einen Verlust von 6 Milliarden und eine Busse von einer Milliarde Dollar verschuldete.
Zusammenfassung des 100-Millionen-Manns
Wenn man die 20’000 Buchstaben zusammenfasst: Thiam kam widerwillig zur CS, sorgte bei der Bank für einen schmerzlichen Turn-Around, brachte sie wieder auf Erfolgskurs und wurde dann nach der Devise «der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen» abserviert. Von einer zutiefst rassistischen Schweizer Gesellschaft, die es nicht ertragen konnte, einen Schwarzen als CEO einer der beiden Grossbanken zu sehen.
Zudem ein Mann, der unbeirrt seinen Weg geht, von der Elfenbeinküste über hochklassige Schulen zu höchsten Positionen, zuletzt bei der Versicherungsgesellschaft Prudential. Bis er den Fehler machte, sich bei den Schweizern zu engagieren.
Das Narrativ ist klar. Aber auch wahr?
Das wäre das Narrativ, das Framing, die klare Aussage des Artikels. Nur: Stimmt das auch? Unterstellen wir, dass alle im Artikel erwähnten Vorkommnisse tatsächlich so stattgefunden haben. Beschreiben sie dann vollständig und ausgewogen die Tätigkeit Thiams?
In einer dermassen langen Strecke hätte sicher Erwähnung verdient, dass Thiam als Chef von Prudential eine Busse von 50 Millionen Pfund kassierte, weil er ein Übernahmeangebot nicht bei der Börsenaufsicht meldete. Eigentlich ein Entlassungsgrund. Aber auch er überlebte das.
Es hätte sicher auch Erwähnung verdient, dass alle, restlos alle Ankündigungen von Thiam über die zukünftige Entwicklung der CS nicht eintrafen. Es hätte vielleicht auch Erwähnung verdient, dass in der Amtszeit Thiams der sowieso schon magere Aktienkurs der CS sich nochmals fast halbierte.
Es hätte vielleicht auch Erwähnung verdient, dass durch Thiams Nachfolger verschiedene seiner Umbaumassnahmen wieder rückabgewickelt werden. Es hätte auch Erwähnung verdient, dass das Erscheinen mit Bodyguards und Helikopter bei Anlässen, zu denen auch Bundesräte mit öffentlichen Verkehrsmitteln und unbegleitet gehen, in der Schweiz tatsächlich Befremden auslöst.
Kritik an Schwarzen kann immer rassistisch sein
Es hätte schliesslich Erwähnung verdient, dass es nicht nur in der Schweiz unüblich und die klare Kriegserklärung an den Verwaltungsrat ist, wichtige Aktionäre zu öffentlicher Kritik am VR aufzufordern. Und es hätte abschliessend Erwähnung verdient, dass man auch die Karte «schwarz» als Trumpf ausspielen kann; Kritiken niedermachen kann, indem man sagt oder andeutet: Wäre der Kritisierte nicht dunkelhäutig, hätte es keine Kritik gegeben. Daher ist sie nicht berechtigt, sondern rassistisch.
Aber da all das nicht in diesem NYT-Artikel steht, der von insgesamt vier Journalisten verfasst wurde, muss man sich leider von der Illusion trennen, dass die NYT weiterhin der Massstab aller Dinge im Journalismus sei. Man kann nur hoffen, dass es sich hier um eine Ausnahme handelt, um einen Ausrutscher. Man muss allerdings gestehen, dass diese Hoffnung nicht allzu gross ist.