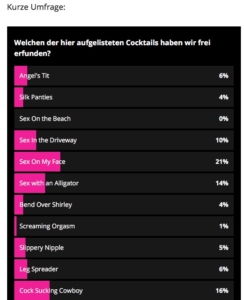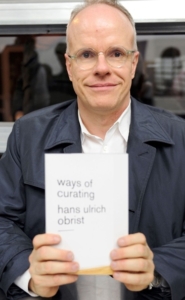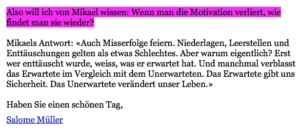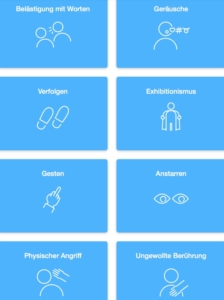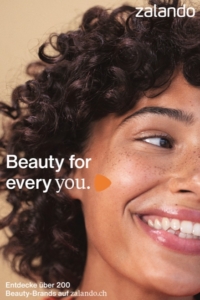Der Steuerstreit lebt noch
Die meisten liessen es bei einer SDA-Meldung bewenden. «Swiss Life zahlt Millionenbusse». Was steckt dahinter?
Flächendeckend, aber eher klein meldeten die übrig gebliebenen Schweizer Medien: «Swiss Life zahlt 77,4 Millionen Busse in den USA». In leichten Varianten, hier die der NZZ, schaffte es die SDA-Tickermeldung in unsere Qualitätsmedien.
Wer sich dafür überhaupt interessierte: Busse für die Verwendung von Versicherungswrappern zwecks Steuerhinterziehung. Ach ja, kalter Kaffee; rund 80 Millionen Dollar – nicht mal dreistellig? Weit weg von einer Milliarde? Also ob das CEO Patrick Frost oder VR-Präsident Rolf Dörig überhaupt zur Kenntnis genommen haben?
Grösster Lebensversicherungskonzern der Schweiz, Jahresumsatz 20 Milliarden Franken; lachhaft. Oder nicht?
Eher oder nicht. Ein Versicherungswrapper ist eine Mantel-Konstruktion. In diesen Mantel werden Vermögenswerte eines Kunden eingepackt. Eingewickelt. Das hat gleich mehrere Vorteile: Mit dieser Umwandlung verschwindet der Name des Kunden aus den Dateien seiner Bank, selbst bei einem neuerlichen Datenklau muss er keine Enttarnung befürchten.
Durch die Verpackung und Aufenthaltsdauer der Kohle erfolgt die Auszahlung sowieso steuerfrei. Und wenn man solche Mäntelchen in Liechtenstein, Luxemburg oder Singapur in den Wind hängt, dann fallen auch sonst keine nennenswerten Steuern an. Super Sache.
Wenn ein Konstrukt einen üblen Ruf bekommt, was tun?
Schon lange hat der Name Wrapper ein Geschmäckle. Nicht, weil es kein normales Substantiv wäre. Aber weil es für eine der letzten Methoden steht, wie man mit überschaubarem Aufwand seine Steuerpflichten, nun ja, optimieren kann. Nachdem vor allem die USA all diese Konstruktionen, inklusive des Missbrauchs des Schweizer Bankgeheimnisses, niedergemacht haben, wäre es vielleicht eine gute Idee gewesen, auch bei diesen Tarnkonstruktionen etwas zu unternehmen.
Gleicher Mantel, neuer Name …
Natürlich, sagte Swiss Life, der Platzhirsch unter den Anbietern, natürlich, sagten alle anderen, die dieses Steuerschlupfloch im Angebot haben. Da werden wir durchgreifen, konsequent. Keine Frage. Wie? Nun, mit zwei alle Probleme lösenden Massnahmen. Schon seit geraumer Zeit lassen sich Versicherungen vom Kunden bestätigen, dass er nur versteuerte Gelder in diese Wrapper einzahlt.
Wichtiger noch: das Zeugs heisst schon länger «Private Placement Life Insurance». Nun ist doch alles bestens. Na ja. 2007 gab Swiss Life bekannt, die Drückerkolonnen von Carsten Maschmeyer zu kaufen, ihm also die AWD abzukaufen, für viel zu viel Geld abzunehmen. Ein Multimillionenflop. 2012 gab Swiss Life den übel beleumdeten Namen AWD auf und schrieb bei der AWD 600 Millionen ab.
Schlecht versichertes Risiko …
Am Tag der Bekanntgabe des Kaufs sackte der Aktienkurs von Swiss Life um 7,5 Prozent ab; was einem vernichteten Börsenwert von 800 Millionen entsprach. Als Swiss Life auch noch bekannt gab, gleichzeitig ein Viertel der Aktien von Maschmeyers MLP AG, einem Finanzdienstleister, übernommen zu haben, verloren die Aktien des Versicherers innert zwei Tagen über 12 Prozent. Noch mal 1,2 Milliarden vom Handelswert verröstet.
Kommt da noch was nach bei den Ummantelungen?
Aus all diesen Gründen ist eine Minibusse wegen Ummantelung doch Peanuts. Eher nein. Noch 2005 lagen bei der Swiss Life in Liechtenstein lediglich 143 Millionen Euro in solchen Versicherungsmänteln, das stieg im Verlauf der Jahre auf über 9 Milliarden Euro. Liechtenstein? Dort gibt’s keine Verrechnungssteuer. Wieso der rasante Anstieg? Nun, natürlich kann das auch Ausdruck eines zunehmenden Bedürfnisses nach Lebensversicherungen sein.
Oder vielleicht eines zunehmenden Bedürfnisses, einigermassen sicher Steuern zu hinterziehen. Inzwischen hat Liechtenstein einiges unternommen, um diese Rufschädigung wegzukriegen. Aber es bleibt doch die Peanuts-Busse, ein Klacks. Schon, dabei ging es aber nur an einem US-Bezirksgericht zur Verhandlung und Sache.
Wenn wir grosszügig annehmen, dass vor der Verjährungsfrist ungefähr die Hälfte der 9 Milliarden Schwarzgelder sind, davon wiederum die Hälfte US-Steuerpflichtigen gehört, kommen wir auf immerhin noch 2,25 Milliarden Schwarzgeld. Und Beihilfe zum Verstecken.
Da werden keineswegs solche Mini-Bussen ausgeschenkt. Da kann Swiss Life gerne die UBS oder die CS fragen. Denn das Geheimnis unter dem Mantel ist noch längst nicht völlig enthüllt. Und ein paar Hintergrundinformationen hätten dem Schweizer Wirtschaftsjournalismus gut angestanden.
Schöne Zahlen der Verpackungsindustrie weltweit
Schon alleine eine Zahl hätte den Lesern die Dimension des Problems bewusst gemacht. Weltweit beträgt der Umsatz der Verpackungsindustrie schöne 100 Milliarden Dollar. Potenzial bis locker 500 Milliarden Umsatz. Sollte da jemand widerstehen wollen?
Die Rechnung ist einfach: Ertrag gegen Aufwand. Ist der Ertrag deutlich höher als der Aufwand (inkl. Bussen und Reputationsschaden), dann kann es ja keinen Grund für Swiss Life geben, die Finger davon zu lassen. Bis die USA dann mal ganz kräftig draufhauen.