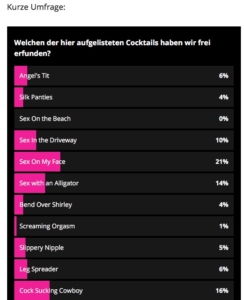Vom Kritiker zum Leibwächter
Vierte Gewalt, unbestechlich, gerecht, kritisch? War mal, ist nicht mehr. Höchstens anders.
Um es zu sagen, wie es ist: die Massenmedien sind – nicht nur – aber vor allem – in der Schweiz auf den Hund gekommen. Das kommt halt davon, wenn man es drei Familienclans überlässt, die Medienszene immer mehr zu beherrschen und schliesslich zu einem Duopol zu degenerieren.
Mit sauber getrennten Gärtchen; wo CH Media regiert, ist Tamedia still, und umgekehrt. Dann gibt’s noch Ringier als nicht mehr so wichtigen, überregionalen Dritten, und die NZZ for the happy few.
Plus eine Latte von Spartenblättern, von Bedienern ihrer Klientel in der miefig riechenden Gesinnungsblase, wo Haltung fast alles, Analyse und Nachdenken fast nichts ist. Gibt es Lichtblicke? Natürlich, jede Menge eigentlich. Während die dummen und verfetteten Medienmanager bis heute noch keine sinnvolle Antwort auf das Internet gefunden haben, spriessen dort natürlich kreative Neupflanzen aus allen Bytes.
Gegenmassnahmen durchaus schräger als erwartet
Allerdings meistens mit sehr überschaubarer Einschaltquote. Aber es gibt auch Versuche, in die Breite zu wirken. Um nicht im Ungefähren zu bleiben, nehmen wir die Ostschweiz. Genau, alles im Einzugsgebiet eines Dialekts, der zu Recht als praktisches Verhütungsmittel angesehen werden kann.
So einfach holt man als Zürcher Sympathiepunkte im Wilden Osten der Schweiz. Nun braucht es nur noch eine kurze Packungsbeilage. Der Autor dieses Artikels publiziert regelmässig in «Die Ostschweiz». Die meisten Zahlen, die hier folgen, hat er überprüft, aber im Wesentlichen geklaut. Aus der «Ostschweiz», woher sonst.
Letzte Packungsbeilage: die Bande zur «Ostschweiz» verfestigten sich, als das «St. Galler Tagblatt» zwar mutig genug war, auf einer Doppelseite einen Artikel von mir über den in St. Gallen residierenden Sherkati-Clan zu veröffentlichen. Aber nicht mutig genug, einem von denen ausgesandten Büttel zu widerstehen, der zwar keinen einzigen sachlichen Fehler bemeckern konnte (ausser einem Dreher von Nach- und Vorname), aber natürlich mit Gewitter, Sturm und auch Hagel drohte.
Also verschwand der Artikel aus dem Netz, um in «Die Ostschweiz» wiederbelebt zu werden.
Die hatte keinen Schiss – und es passierte natürlich auch nix. Das die Ouvertüre.
Als reitender Bote hat’s der Mainstream schwer
Denn «Die Ostschweiz» klopft sich etwas auf die Schulter. Da erledigt ihr VR-Präsident Peter Weigelt persönlich.
«15. April: 46’000 Single Visitors an einem Tag. Rekord bislang.»
Es geht also offenbar, ein reines Internet-Newsmedium mit Tentakeln in die Realität wie ein Magazin zu lancieren. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber stetig.
Er hält aber nicht nur Nabelschau, sondern exemplifiziert die Misere der Medien in der Schweiz an ein paar einfachen Zahlen. «Alle vier grossen Medienkonzerne haben mit Blick auf massive staatliche Beihilfen – sprich Subventionen – ihre Aufgabe als 4. Gewalt im Staat aufgegeben. Sie haben sich zu reinen «Verlautbarungs-Medien» gewandelt», sagt VRP Weigelt.
Er untermauert das dann mit Zahlen. Zusammen mit der Posttaxenverbilligung, dem reduzierten Mehrwertsteuersatz und weiteren Vergünstigungen flossen den Tagblatt-Medien damit allein 2020 insgesamt über 10 Mio. Franken an staatlichen Unterstützungsbeiträgen zu. Also elektronische und Printmedien zusammengezählt.
In Zukunft sollen, nach den letzte Beschlüssen des Parlaments insgesamt jährlich rund 400 Millionen Franken an die Medien verteilt werden. Plus die 1,4 Milliarden Franken, die durch Radio- und TV-Gebühren in den staatsfernen Kleinstkonzern SRG fliessen. Wovon ein Bruchteil als Zückerchen an die Medienkonzerne abgegeben wird, die keine Mühe damit bekunden, ihre Meinung je nach Wetter- und Subventionslage anzupassen.
Auch andere Zeitungen sagten schon, sie seien unabhängig und staatsfern
Die Corona-Politik des Bundesrats ist nun wirklich echt unfähig? Dieser Kantonsrat muss weg? Wie kann der Nationalrat nur? Wären alles ganz schlechte Storyideen für einen subventionierten Konzern.
Nicht nur Kunst geht nach Brot. Es ist eine absurde Annahme, dass staatlich subventionierte Medien so kritisch bleiben wie staatlich nicht subventionierte Medien. Das ist so bescheuert, wie wenn die Parteizeitungen «Prawda» oder «Neues Deutschland» behauptet hätten, unabhängig von ihrer völligen Abhängigkeit vom Staat Berichterstattung zu betreiben. Nur und alleine der Wahrheitsfindung verpflichtet.
Ach, das haben die behauptet? Tja, da gab es aber nicht viele Leser, die das auch geglaubt haben.