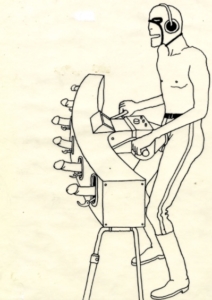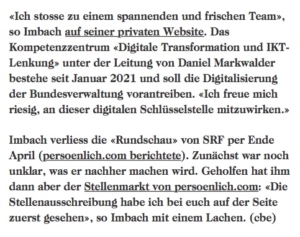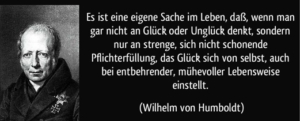Leistungsabfrage
Salome Müller, bald Ex-Tamedia, und Aleksandra Hiltmann: was leisten die eigentlich?
Die beiden haben sich etwas geleistet. Einen gelungenen Versuch, mit bislang völlig unbelegten Behauptungen den Ruf ihres Arbeitgebers zu bekleckern. Unerträgliche Zustände, triefend vor Sexismus, Frauendiskriminierung, demotivierend, gravierend, in die Flucht treibend.
So ihr vernichtendes Fazit in einem Protestschreiben, das sie pünktlich zum Tag der Frau vor drei Monaten auf die Rampe schoben und durch Jolanda Spiess-Hegglin in die Öffentlichkeit schieben liessen. Ohne dass das alle Unterzeichnerinnen gewusst oder gar gebilligt hätten.
Tamedia eierte (Pardon) eine Weile rum, um dann markig zu verkünden, dass nun das Bestreben sei, auf allen Hierarchiestufen 40 Prozent Frauenanteil zu etablieren. Seither wird gemunkelt, dass sich im Geheimen Männerverteidigungsgruppen bilden, die konspirativ ihren Überlebenskampf vorbereiten.

Weil man von den beiden Rädelsführerinnen nach ihrem Auftritt bei «10 vor 10» nicht mehr viel hörte: was tun die eigentlich sonst so? Stehen doch bei Tamedia, diesem Schweinebackenkonzern, auf der Gehaltsliste und verdienen ziemlich gut, sowie sicher und mit Fringe Benefits sowie generösen Fortbildungsmöglichkeiten.
Leistung in einem Mondzyklus gemessen
Also, neben motzen, fordern und leiden, wie sieht denn die Leistungsbilanz aus? Nehmen wir einen Mondzyklus, moderner formuliert: den Ausstoss in den letzten 30 Tagen. Wir schicken voraus, dass beide Journalistinnen den Verlag zusammen so rund 20’000 Franken gekostet haben dürften. Lohn, Lohnnebenleistungen, Sozialversicherungen, Arbeitsplatz plus Infrastruktur.

Wir nehmen auch hin, dass ZACKBUM hier mal wieder typisch männliches Leistungsbewusstsein, Konkurrenzdenken, Längenvergleich usw. an den Tag legt; also all das, was sensible Frauen so hassen. Zu Recht, kann man bei diesen beiden Grossschriftstellerinnen nur sagen. Ganz knapp die Nase vorn hat in diesem Zeitraum – Aleksandra Hiltmann. Sie hat einen Output von ganzen zehn Wortmeldungen. Grob unterteilt in 3 Kommentare und 7 Artikel, worunter auch Interviews fallen.
Also jeden dritten Tag durfte man etwas von Hiltmann lesen. Wir hier bei ZACKBUM.ch halten es umgekehrt; jeden Tag drei Stücke. Dafür unbezahlt. Aber eben, blödes Machogetue. Ausserdem kommt es doch auf den Inhalt, nicht die Menge an. Nun ja, eine einfühlsame Kolumne über ihren «Impfarm», ein Stück über die Unsichtbarkeit von Menstruationsblut in der Öffentlichkeit, das setzt natürlich ein Niveau, zu dem wir hier nichtmal hinaufblicken können. Oder hinab? Egal, Output 10.
Im Schlafwagen durch den Journalismus
Salome Müller bringt es in der gleichen Periode, also in einem Monat, Pardon, auf ganze 8 Stück. 1 Kommentar, 5 Artikel und zweimal ist sie als Mitautorin erwähnt. Also alle vier Tage wurde die Welt besser, weil sich Müller zu ihr äusserte. Ist ja auch nicht nix. Aber auch nicht viel mehr.

Kassensturz: 1111 Franken liess sich Tamedia jedes Werk der beiden Damen kosten. Ein teurer Spass, eigentlich, viel Spass hat’s auch nicht gemacht. Nicht mal den Autorinnen, denn sie mussten ja ihr Werk weiterhin unter frauenunwürdigen Zuständen verrichten, demotiviert, belästigt, ohne Anstand behandelt.
Aber immerhin, Müller hat sich – völlig freiwillig – für die Freiheit entschieden, den Ausbruch, den Aufbruch. Zukünftig müssen sich die triebhaften Machomänner von Tamedia ein anderes Objekt ihrer unsauberen und unanständigen Gedanken suchen. Denn Müller wird demnächst eine Lücke hinterlassen, die sie nicht nur vollständig und unmerklich ersetzt. Sondern es geht jetzt schon ein Aufatmen durch die Reihen. Der Männer, selbstverständlich. Aber auch der Leser, die nicht mehr länger mit Gendersternchen und ähnlichem Unsinn belästigt werden.