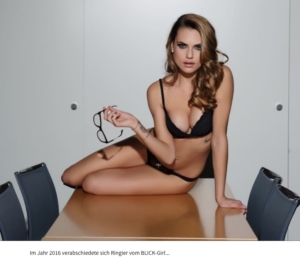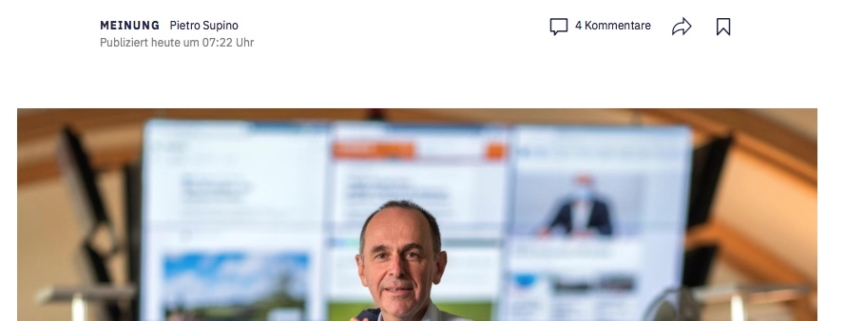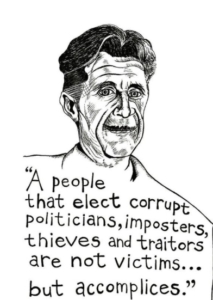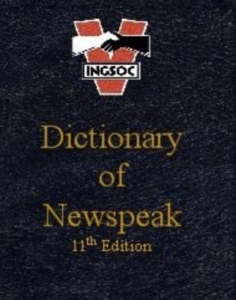Der Liebe und des Senders Wellen
Barbara Lüthi ist Moderatorin des «Club» auf SRF. Der wird harsch kritisiert. Das wird intransparent, beziehungstechnisch.
Die Partei mit dem gelben Sünneli sieht rot. Der «Club» vom 1. Juni hat sie äusserst echauffiert. «Fass zum Überlaufen gebracht», «Beschwerde», «politisch vorgehen». «Ideologisch geleitete Aktivisten, die sich unverhohlen für linke Anliege einsetzen», das aus ihrer Sicht Links-TV vom Leutschenbach hat der sonst so sanftmütigen und mit gewählten Worten politisierenden SVP den Nuggi rausgehauen.

Die SVP über das «NGO-TV» von Leutschenbach.
Genauer der «Club» vom 1. Juni, der sich mit den Folgen des gescheiterten und beerdigten Rahmenabkommens befasste. Da seien doch drei «Euroturbos» eingeladen worden, aber:
«Vollständig inakzeptabel ist, dass kein Vertreter der SVP zugegen war.»
Schliesslich sieht sich die SVP seit 1291, Pardon, seit 1992 als Verteidigerin der Schweizer Unabhängigkeit gegen österreichische und fremde Vögte. Was Übervater Christoph Blocher begann, wird nun mit dem Scheitern des Rahmenvertrags vollendet. Meint die Partei. Dann darf sie nix Triumphierendes in dieser Diskussionsrunde sagen, das tut natürlich weh.

Im Visier der SVP: Barbara Lüthi (Bildzitat «Schweizer Illustrierte»).
Deshalb droht sie: «Dieser einseitige links-grüne Aktivisten-Journalismus muss gestoppt werden.» Mitten im Feuer steht Barbara Lüthi und der seit 2018 von ihr moderierte «Club». Überraschungsfrei sieht das der Zwangsgebührensender SRF anders. In einer «Stellungnahme zu den Vorwürfen der SVP» nimmt «Gregor Meier, Stellvertretender Chefredaktor CR Video, Stellung dazu».

Seine Argumentation ist aus dem Stehsatz gegriffen; die SVP sei im Fall überhaupt nicht untervertreten, dürfe ständig mitdiskutieren, jetzt halt einmal nicht: «Es ging darum, andere Facetten aufzuzeigen ausserhalb der Parteipolitik.» Da wanke SRF nicht: «In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zu betonen, dass wir uns nicht von den Parteien vorschreiben lassen, wen wir in welche Sendung einladen.»
Alles ausgewogen, vielfältig – und transparent …
Und überhaupt, legt Meier nach, «SRF berichtet weder tendenziös noch verletzen wir die journalistische Sorgfaltspflicht. SRF berichtet unabhängig, ausgewogen und vielfältig. SRF ist kein Parteimedium – von keiner Partei».

Talking Head: Gregor Meier.
Dazu natürlich transparent, offen und folgt allen Regeln der Corporate Governance, also der guten Geschäftsführung oder Leitung nach modernen Kriterien. Nun könnte man meinen, dass ein solch fundamentaler Angriff der grössten Partei der Schweiz eine Antwort von oberster Stelle verdienen müsste. Nämlich vom verantwortlichen Vorgesetzten von Barbara Lüthi, der im Ernstfall auch disziplinarische oder andere Massnahmen einleiten könnte. Das wäre in diesem Fall Tristan Brenn, seit 2014 Chefredaktor TV.

Silent Head: Tristan Brenn.
Leider funktioniert in der damaligen Jubelmeldung der Link zu Brenns Biographie nicht. Daher muss hier ein in diesem Zusammenhang nicht uninteressantes Detail aus seinem Leben verraten werden: Brenn ist der Lebensgefährte von Lüthi.
Ach, die Liebe, die schon Grillparzer bedichtete
Die Liebe ist eine Himmelsmacht, aber wenn ein Vorgesetzter mit einer Untergebenen zarte Bande unterhält, ist das in wirklich transparent und nach modernen Kriterien geführten Unternehmen ein kleines Problem. Vor allem, wenn es eben wie hier darum geht, wer denn die Herzallerliebste gegen Angriffe von aussen verteidigt.
Daher fragen wir doch Brenn direkt: Halten Sie es mit den Grundlagen von Corporate Governance vereinbar, dass Sie als Lebensgefährte von Frau Lüthi diese Stellungnahme an Ihren Stellvertreter delegieren müssen?
Brenn: «Ja. Gregor Meier ist als stellvertretender Chefredaktor der Abteilung (seit 1. April: Chefredaktion Video) mit allen Entscheidungsbefugnissen ausgestattet und nimmt immer wieder gegen aussen Stellung zu SRF. Was den «Club» angeht, entscheidet Gregor Meier zusammen mit der Redaktion alleine und trägt zusammen mit der Redaktion die volle publizistische und personelle Verantwortung. Die involvierten Redaktionen und Vorgesetzten, inklusive HR und Direktion sind in voller Transparenz darüber informiert. Die Stellungnahme von Meier ist deshalb vereinbar mit der Corporate Governance von SRF.»
Knapper ist seine Reaktion auf die Nachfrage: Wäre es im Rahmen von Transparenz, Anstand und in Rücksichtnahme auf das dadurch entstehende Image von SRF nicht sinnvoll gewesen, wenn Sie hier Transparenz schaffen würden? «Siehe Antwort 1.» Lüthi wollte keine Stellung nehmen.
Ist diese Auffassung über Transparenz keine News wert?
Brenn ist also der Auffassung, dass diese Art der Stellungnahme durch seinen Stellvertreter, wobei niemand weiss, wieso er nicht selbst das Wort ergreift, mit der Corporate Governance von SRF «vereinbar» sei, weil alle «Involvierten in voller Transparenz drüber informiert» seien.
Schon, aber die Quantité negligable des TV-Zusehers und Gebührenzahlers nicht. Den geht – bei aller Transparenz – der Grund dafür einen feuchten Kehricht an, wieso nicht der oberste Vorgesetzte von Lüthi und Chef der ebenfalls angegriffenen Nachrichten-Abteilung von SRF das Wort ergreift. Solange «intern» alles cremig bleibt.
Ob die SVP mit ihrer Kritik recht hat oder links oder nicht, das muss in der Debatte entschieden werden. Dass ein solches Vorgehen und eine solche Reaktion des obersten Nachrichten-Verantwortlichen des wichtigsten News-Senders der Schweiz nicht tolerierbar ist, das dürfte diskussionslos klar sein.