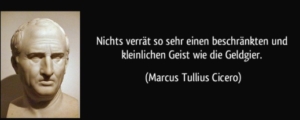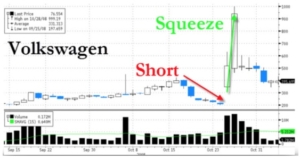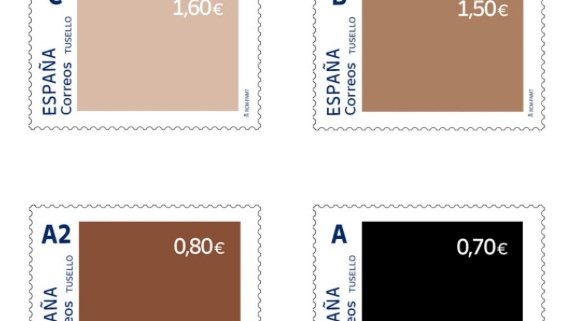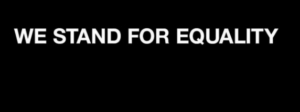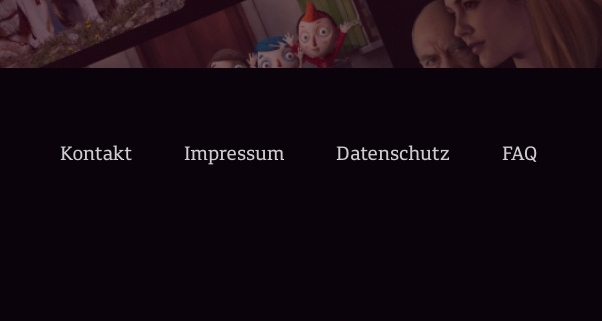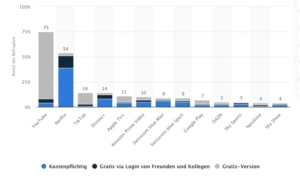Berichten, was relevant ist
Gute Ansage. Gute Idee. Aber wenn ewig der eigene Bauchnabel näher ist als die Welt?
Der Journalist, so steht’s sicher in einem verstaubten Lehrbuch, hat die vornehme Aufgabe, die Welt zu kartographieren. Zu berichten, was sich so alles abspielt, nah und fern. Da das etwas mehr ist, als in eine Zeitung passt, muss er auch noch das Relevante auswählen und gewichten.
So viel zur schönen Theorie. Gehen wir in die hässliche Praxis. «Blut, Busen und Büsis für die Romandie», gleich zwei Werke ist dem «Tages-Anzeiger» das welterschütternde Ereignis wert, dass es neuerdings auch eine Online-Ausgabe des «Blick» auf Französisch gibt. Das mag ja den Westschweizer Leser allenfalls am Rande interessieren.
Aber hier in der Deutschschweiz? Echt jetzt, und auch noch einen Podcast obendrauf? In dieser Ausführlichkeit? Absurd. Gesteigert werden kann das nur noch auf eine Art: Tamedia berichtet über diese Expansion, vermerkt, dass auch «watson» aus dem Hause CH Media schon in die Romandie eingedrungen ist.
Die Westschweiz (rot eingefärbt).
Dass man der Konkurrenz von Herzen alles Schlechte wünscht, ist menschlich verständlich. Das Tamedia mit keinem Wort erwähnt, dass dieser Konzern der Platzhirsch bei den französischsprachigen Medien in der Schweiz ist – das ist wieder mal ein kräftiger Beitrag zur Förderung der Glaubwürdigkeit.
Nur Bäumchen werden ausgerissen
Auch im Lieblingsgeschäft der modernen Journalisten reisst Tamedia nur ganz kleine Bäumchen aus. Wenn man der Welt mangels Ressourcen dafür schon nicht näher kommen kann, dann gibt’s ja immer noch den Kommentar. Den der Tag rückt immer näher, an dem der frisch eingestellte Kindersoldat im Newsroom, nachdem ihm seine Verrichtungsbox auf einem halben Meter Breite und Tiefe zugewiesen wurde, verschreckt fragte: Aber ich dachte, dass sei ein Bürojob. Ich soll jetzt echt rausgehen und reportieren? Aber es regnet doch!
Stattdessen lieber ein Kommentar. Zu aktuellen Ereignissen. Oder zu längst vergangenen, noch besser. Wenn das Ereignis passiert ist und schon etwas abgehangen zu müffeln beginnt, ist der beste, weil sicherste Moment, dran zu schnuppern und die Ergebnisse der Schnüffelei dem Leser zu servieren.
Das tut der unermüdliche Michael Hermann, der sich nicht einkriegen kann, dass der Bundesrat doch tatsächlich eingesehen hat, dass das Rahmenabkommen dermassen aus dem Rahmen gefallen ist, dass man die Leiche endlich ruhen lassen sollte, statt versuchen, sie immer wieder wachzuküssen.

Hermann ist dabei unangenehm aufgefallen, dass die Gegner eines vernünftigen Zusammenwucherns im Hause Europa, wo die Schweiz in der Mitte doch nicht abseits stehen könne, mit dem Argument arbeiten, dass sie an Souveränität verlieren könnte.
Ganz falsch, doziert Hermann. «Die Schweiz agiert ängstlich, wenn es um ihre Selbstbestimmung geht», behauptet der Wissenschaftler eingangs. Das ist natürlich bedauerlich, liebe Schweiz. Man stelle sich vor: Helvetia kauert ängstlich in einem noch nicht zur Touristenattraktion umgewidmeten Gotthard-Reduit in der Ecke und bibbert. Wie man kann das arme Wesen wieder ans Tageslicht der europäischen Sonne führen?
Souveränes Denken mit Hermann
Da hat Hermann eine merkwürdige Idee. Dieses Mäandern muss man in voller verwickelter Länge geniessen:
«Die Covid-19-Situation ist nicht zuletzt ein Stresstest für die Handlungsfähigkeit von Staaten und damit im Kern auch für das Ausmass ihrer Souveränität. Mit ihren eigenständigen Strategien haben Dänemark und Schweden in besonderem Mass ihr Vermögen unter Beweis gestellt, selbstbestimmt zu handeln. Und hier kommen wir bereits zum eigentlichen Clou: Beide Staaten sind hochgradig souverän, obwohl beide EU-Vollmitglieder sind.»
Wer ZACKBUM erklären kann, was Hermann uns damit sagen will, bekommt die Medien-Verdienstmedaille am Band mit Brillanten (falsch, aber glitzern) verliehen. Auch der Nachsatz zum Clou macht’s nicht wirklich verständlicher: «Was wir in der Schweiz dabei gerne vergessen: Souveränität misst sich nicht am Ausmass des Abseitsstehens.»
Aha, wer’s immer noch nicht verstanden hat (wir zum Beispiel), dem greift Hermann noch paartherapeutisch unter die Arme, sich dabei auf «unsere zwischenmenschliche Erfahrung» stützend:
«Es gibt Personen, die sind stark eingebunden und leben dennoch selbstbestimmt, und andere, die halten sich aus allem raus und schaffen es doch nicht, ihr Leben selber zu bestimmen.»
Wir befürchten nun, dass Hermann als Paartherapeut ungeeignet wäre. Allerdings ist er es auf seinem Gebiet auch. Zudem ist er beratungsresistent. Denn zur Abrundung singt er noch Lobeslieder auf ausgewählte EU-Staaten, die trotz Mitgliedschaft ganz furchtbar souverän seien und vor allem die Schweiz auf diversen Gebieten längst hinter sich gelassen haben. Der Letzte, der diese Nummer probierte, war der unermüdliche WeWo-Kolumnist und ehemalige SP-Chef Peter Bodenmann. Der sang über Jahre hinweg das Lied, wie toll es doch Österreich ginge, wie die uns Schweizer so was von abhängen würden, eigentlich auf allen Gebieten besser und besser werdend, möglicherweise mit Ausnahme des Käsefondues.
Bei denen geht’s ab, in der Schweiz herrscht Stillstand, Rückschritt, Gejammer, bald werden wir wieder auf den Alpen Kühe hüten und zur Selbstversorgung zurückkehren. Weil wir Deppen nicht in der EU sind. Aber seit geraumer Zeit, hat Bodenmann diesen Wortsalat auf den Schindanger geworfen und möchte nicht mehr daran erinnert werden. Er wird aber auf den Stockzähnen grinsen, dass Hermann nun diesen toten Gaul nochmal reiten will.