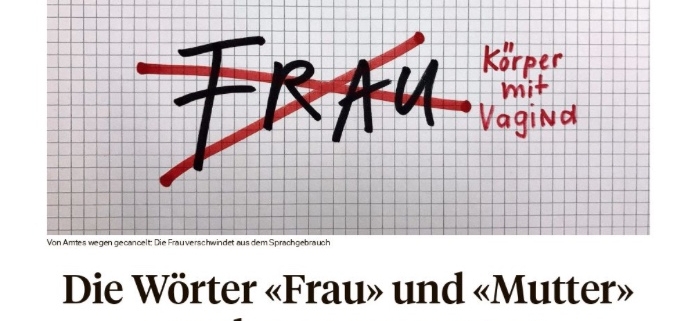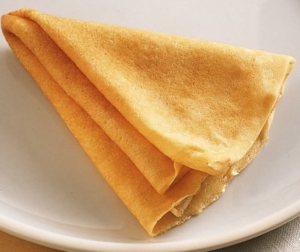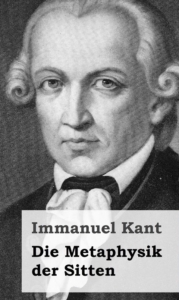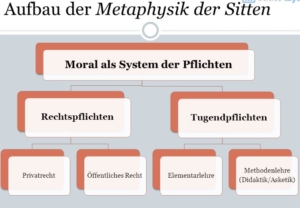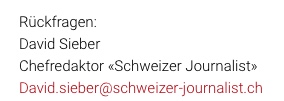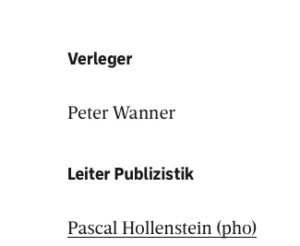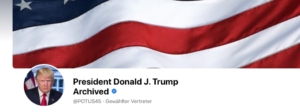Die Walliserkanne des Wahnsinns
Ein neues Beispiel der Verluderung der Medien. Allerorten.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Die News ist schnell erzählt. Die Wirte einer Kneipe im Wallis weigern sich, die Zertifikatspflicht bei ihren Gästen zu kontrollieren. Sie werden mehrfach ermahnt, dann wird ihnen das Lokal geschlossen, der Eingang verbarrikadiert. Als sie dennoch weiter Gäste empfangen, werden sie verhaftet und in U-Haft genommen.
Daran kann man natürlich tiefschürfende Ansichten über Widerstand, Verhältnismässigkeit, Eskalation oder Schuld anschliessen. Oder man kann sich lächerlich machen.
Das gelingt eigentlich allen medialen Beobachtern bestens. Hubert Mooser gerät auf «Weltwoche Daily» in Wallungen:
«Man hört die Schreie der Betroffenen, als diese von den Beamten mit Härte überwältigt werden.»
Er hatte nicht nur sein Hörrohr nahe an der «wildwest-reifen Szene»: «wie Schwerverbrecher, gewaltiger Image-Schaden, wer hat diese überrissene Polizei-Aktion angeordnet?»
Eine Joyce Küng legt noch nach: «Jedes Fünkchen Widerstand gegen die Bekämpfungsmassnahmen einer Krankheit mit einer Überlebenschance von 99,7%, stellt sich als störend dar. Wie sonst soll die Behörde die Verordnungen rechtfertigen, wenn renitente Demonstranten ständig auf die Verhältnismässigkeit hinweisen?»
Der Boulevard hingegen legt sein Ohr an Volkes Mund: «Über die Verhaftung der Wirte am Sonntagmorgen sei der Grossteil der Einwohner und der Gastronomen erleichtert, meint ein Zermatter zu Blick.»
Es gibt Zweifel an der Verhältnismässigkeit
«Blick» berichtet allerdings auch von den Erlebnissen eines nicht unbekannten Augenzeugens, des Gastrounternehmers Mario Julen, der sich als Vermittler angeboten habe und deshalb beim Polizeieinsatz vor Ort gewesen sei: ««Im Rudel ging die Polizei auf die Familie los, mit Fäusten und Schuhen — und zwar ohne Vorwarnung.» Die Familie habe sich zunächst nicht gewehrt. Trotzdem sei Mutter Nelly «zusammengeschlagen», dem Sohn Ivan «die Schulter ausgerenkt» und dem Vater Andreas in den «Nacken geschlagen worden», beschreibt der Einheimische den Einsatz. «50 Polizisten» seien dabei gewesen, die auch ihn dann weggedrängt hätten. »
Das wiederum macht die Polizei ranzig: «Wir distanzieren uns in aller Form von diesen Vorwürfen. Der Einsatz der Polizei lief verhältnismässig ab. In diesem Zusammenhang prüfen wir derzeit, rechtliche Schritte einzuleiten.»
Zuvor hatten die Medien die Staatsorgane harsch kritisiert; so keifte der «Walliser Bote»: «Der Staat darf sich nicht von einem renitenten Wirt auf der Nase herumtanzen lassen. Man muss Härte zeigen.»

Harte Sache, für den «Walliser Bote».
Auf der anderen Seite zeigt Nicolas A. Rimoldi, wie man sich lächerlich machen kann und der eigenen Sache Schaden zufügen: «Die Schweiz nimmt politische Gefangene! Das wird nicht geduldet. Ich fahre also nun erneut von Luzern nach Zermatt. Das Mass ist voll!» «Freiheitshelden, Opfer der Behördenwillkür, Zermatter Mauer», japst er noch, und: «Ich würde es nicht verurteilen, würden unerschrockene Bürger mit schwerem Gerät die Mauer zerstören.»
Er meint damit die Betonblöcke, die die Behörden nicht sehr elegant vor den Eingang des Lokals gewuchtet hatten, als ihr Schliessungssiegel an der Türe immer wieder aufgebrochen wurde.
Man kann’s auch literarisch sehen
Die NZZ hingegen nimmt Zuflucht zur Literatur, stellt den Vorgang in «vier Akten und einem Epilog» dar: ««Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen / den Vorhang zu und alle Fragen offen.» (Bertolt Brecht, «Der gute Mensch von Sezuan»)» Das nennt man wohl Verfremdung im Sinne des epischen Theaters.

Ausgerechnet mit Brecht: die alte Tante NZZ.
Auch der «Schweizer Bauer» steht den Ereignissen nicht unkritisch gegenüber:
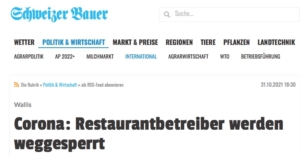
«Weggesperrt» hört sich nicht freundlich an.
Anschliessend, Überraschung, sagen Politiker dies und das, kritisieren und fordern, verlangen und postulieren.
Schliesslich wagt sich noch Edgar Schuler von Tamedia an einen Kommentar. Der Mann, das muss man ihm nachsehen, war dazu verurteilt, mit Salome Müller, der Sternchen-Fee, den NL des Tagis herauszugeben und musste sich schwer zusammenreissen, damit er nicht auch als Beispiel für die fürchterlich demotivierende, sexistische und diskriminierende Schreckensherrschaft der Tamedia-Männer herhielte.
![]()
Scharf beobachtet: Die «Walliserkanne» sei nicht das Rütli.
Aber nun ist er befreit und darf ungehemmt his master’s voice geben. Denn Tamedia findet bekanntlich Corona-Skeptiker jeder Art bescheuert und tut alles dafür, dass das verschärfte Corona-Gesetz angenommen wird.
Dafür ist jedes Borderline-Verhalten sehr willkommen. Als ob eine Walliser Wirtefamilie einen entscheidenden Beitrag dazu leisten würde, mit ja oder nein zu stimmen, wenn es darum geht, ob ein Gesetz in Kraft treten soll, von dem ein renommierter Verfassungsrechtler in der NZZ sagt:
«Das demokratisch gewählte höchste Organ des Bundes hat mit dem Covid-19-Gesetz und seinen Änderungen zwei wichtige Artikel der Bundesverfassung missachtet und die schweizerische Demokratie grob beschädigt.»
Dabei handelt es sich nicht um einen Walliser Wirt, sondern um Andreas Kley, Professor für öffentliches Recht, Verfassungsgeschichte sowie Staats- und Rechtsphilosophie an der Universität Zürich. Aber das ist Kommentarschreibern wie Schuler schnurz.