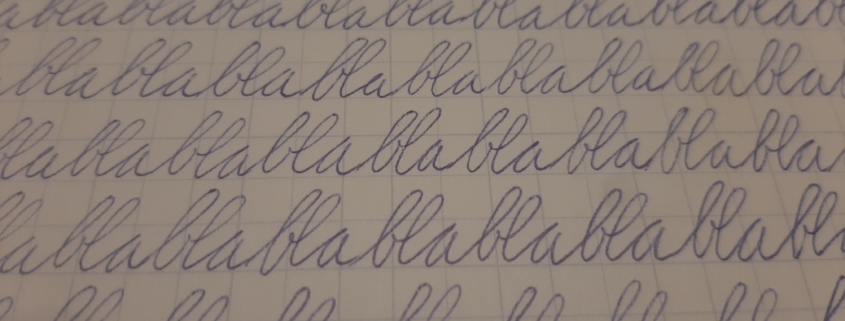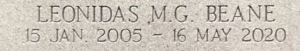Arbeitslosengeld: Tamedia 4,2 Millionen, Blick und NZZ nichts
Wie die Grossverlage mit der Coronakrise und mit der Kurzarbeit umgehen. Eine Exklusivumfrage von ZACKBUM.ch fördert Erstaunliches ans Tageslicht.
Allein im Kanton Zürich wurde während des Corona-Lockdowns im April und Mai für gut einen Drittel der Arbeitnehmer Kurzarbeit beantragt. Mit dieser Kurzarbeitsentschädigung sollte die Arbeitslosenversicherung einen Teil der Lohnkosten übernehmen. Damit soll verhindert werden, dass infolge kurzfristiger und unvermeidbarer Arbeitsausfälle Kündigungen ausgesprochen werden. Wie sieht die Lage bald sechs Monate später in der Medienbranche aus? Gibt es Missbräuche? Werden viele Angestellte trotzdem entlassen?
Tamedia verlängert Kurzarbeit bis Ende November
Das einzige börsenkotierte Medienunternehmen der Schweiz, die TX Group mit dem Tamedia– und dem 20-Minuten-Zweig, nutzt die Möglichkeit der Kurzarbeit am extensivsten aus. Laut einer Sprecherin «befindet sich Tamedia seit April 2020 in Kurzarbeit – anfangs die gesamte Belegschaft, mittlerweile sind es rund 50 Prozent der Mitarbeitenden – also die ganze Tamedia, inkl. Druckzentren.»
Man habe «aufgrund der nach wie vor unsicheren konjunkturellen Lage, insbesondere im Werbemarkt, eine Verlängerung bis vorerst Ende November 2020 beantragt«. Dazu erfolge eine laufende Neubeurteilung mit dem Ziel, «so rasch wie möglich wieder in den Normalbetrieb zurückkehren zu können». Die Sprecherin betont, die Kurzarbeit stehe im Zusammenhang mit den enormen wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19. Und: «Die Medienbranche befindet sich jedoch bereits seit längerem in einem anhaltenden strukturellen Wandel, die Werbeeinnahmen sind seit Jahren rückläufig und es ist davon auszugehen, dass sich der negative Trend fortsetzen wird.»
Immerhin: Tamedia bezahlt allen Angestellten trotz Kurzarbeit den vollen Lohnausgleich. Tamedia erhielt bis Ende Juni eine Kurzarbeitsentschädigung von 4,2 Millionen Franken, wie es auf Anfrage heisst.
«20Minuten»: Völlig offen, wann der Normalbetrieb kommt
Bei «20Minuten», welche innerhalb der TX Group eine wirtschaftlich eigenständige Einheit darstellt, sieht die Situation ähnlich aus. Laut Sprecherin Eliane Loum wurde von Ende März bis Ende August insgesamt rund 25 Prozent Kurzarbeit geleistet. «Anfangs waren alle Mitarbeitenden in Kurzarbeit, mittlerweile konnten einzelne Abteilungen aus der Kurzarbeit herausgelöst oder diese reduziert werden«, so Loum. «Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende November noch rund 20 Prozent Kurzarbeit leisten werden. Derzeit ist noch völlig offen, ob wir auf Anfang Dezember alle wieder zum Normalbetrieb zurückkehren können oder ob wir einen Antrag auf Verlängerung der Kurzarbeit stellen werden. Das ist abhängig von der Entwicklung des Werbemarktes.» Bezogen hat «20Minuten» bis Ende August eine Million Franken via Kurzarbeitsausgleich. Und wie schaut «20Minuten», dass die bewilligte Kurzarbeit nicht überschritten wird? Man habe während der Krise insbesondere die Zeitung stark reduziert, teilweise sei sie noch immer reduziert. «So haben wir beispielsweise während 4 Monaten auf die Publikation der Regionalausgaben verzichtet, da regionale Kultur- und Sportveranstaltungen fast vollständig abgesagt wurden. Die dort bei den Journalistinnen und Journalisten frei werdenden Ressourcen konnten anders eingesetzt werden.» Dass «20Minuten» bald nur noch online erscheinen könnte, verneint Loum vehement.
CH Media mit 1200 Mitarbeitern in Kurzarbeit
Bei CH Media, dem Zusammenschluss der Zeitungen der AZ Medien und der NZZ-Landzeitungen, arbeiteten von April bis Ende August «ungefähr 60 Prozent der rund 2000 Mitarbeitenden in unterschiedlicher Ausprägung Kurzarbeit», wie eine Mitarbeiterin der Unternehmenskommunikation mitteilt. Die Differenz zum 100%-Lohn wurde immer ausgeglichen. Seit 1. September werde für CH Media als ganzes Unternehmen keine Kurzarbeit mehr beantragt. «Punktuell kann es nach wie vor Bereichsabteilungen oder Gesellschaften geben, wo Kurzarbeit beantragt wird», so die Sprecherin. Wieviel Geld CH Media bezogen hat bisher via Kurzarbeitsausgleich, will man aber nicht sagen. Und wie kann CH Media sicherstellen, dass die bewilligte Kurzarbeit nicht überschritten wird? – «Es wird immer die tatsächlich geleistete Arbeitszeit erfasst, somit wird nur die Differenz von Sollpensum zum tatsächlich geleisteten Pensum als Kurzarbeit beantragt.» Entlassen wurden im laufenden Jahr «etwa 10 Mitarbeitenden im Rahmen von Reorganisationen für die Zusammenführung des Joint Ventures CH Media».
Watson ohne Einschränkungen
Nie ein Thema war Kurzarbeit beim Online-Portal «Watson», wie es auf Anfrage heisst. «Watson» gehört zur AZ-Mediengruppe, ist also nicht ins CH Media-Konstrukt übernommen worden. A propos online. Das Magazin Nau.ch wurde ja vom Konkurrenz-Produkt Republik.ch rau angegangen. Die Vorwürfe: Man trickse bei der Kurzarbeit und fordere die Mitarbeitenden auf, trotzdem mehr als erlaubt zu arbeiten. Chefredaktor Micha Zbinden zum Thema Kurzarbeit: «Die Kurzarbeit bei Nau.ch ist längst beendet und wir sehen in der aktuellen Lage auch keine Gründe, von dieser erneut Gebrauch zu machen. Interne Zahlen können wir Ihnen aus Datenschutzgründen nicht bekanntgeben», so der ehemalige Blick-Sportchefreporter. Und die Anwürfe der «Republik»? Zbinden holt aus, will das aber nicht zitiert haben. Nur so viel: Die Geschichte werde noch ein Nachspiel haben.
Republik reagiert zweimal nicht
Die Republik reagiert als einziges angefragtes Medium nicht auf die ZACKBUM-Recherche, auch nicht aufs zweite E-Mail. Erst nach telefonischem Nachhaken heisst es, man habe a) nie Kurzarbeit beantragt und b) niemanden wegen der Corona-Krise entlassen. Weil die Republik keine Werbung schaltet und mehr oder weniger von den aktuell über 20000 Abonnentinnen und Abonnenten lebt, sind die Antworten plausibel.
Blickgruppe ohne Kurzarbeit…
Wie sieht es denn bei Ringier aus? Johanna Walser, Head of Public Relation, dazu: «Es gab vereinzelt Kurzarbeit im Mai und Juni. In der gesamten BLICK-Gruppe gab es aber zu keinem Zeitpunkt Kurzarbeit.» Bei Radio Energy wurde im Mai und Juni ebenfalls Kurzarbeit angeordnet, allerdings nicht für die Redaktion und den Programmbereich. Beim Betriebszweig RASCH (u.a. Beobachter, Bilanz, Glückspost, SI) gab es ebenfalls vereinzelt Kurzarbeit im Mai und Juni – auch in den Redaktionen. Aber: Die Differenz zum Lohn wurde überall ausgeglichen. Ab 1. September gibt es laut Walser für die Redaktionen keine Gesuche um Kurzarbeit mehr. Wieviel Ringier bisher via Kurzarbeitsausgleich bezogen hat, will Walser – im Gegensatz zur TX Group – nicht sagen.
… Ringier aber mit Entlassungen
Beim Ringier-Konzern wurden 2020 (u.a. wegen der Corona-Krise) bei L´illustre 8 Stellen abgebaut, darunter 4 Entlassungen. Bei RASCH wurden wegen der Einstellung des Modemagazin Style, wegen der Auslagerung von Bolero sowie der Zusammenführung der Redaktionen von Schweizer Illustrierte und SI 31 Stellen abgebaut. Dies die Angaben von Johanna Walser.
NZZ: Keine Lohneinbussen, aber düstere Wolken
Bleibt von den Grossverlagen die NZZ. Auf Anfrage erklärt Seta Thakur, Leiterin Unternehmenskommunikation, dass «derzeit niemand bei der NZZ-Mediengruppe in Kurzarbeit arbeitet. Sie wurde per Ende Juni aufgehoben.» Die Löhne der Mitarbeitenden, die von April bis Juni in Kurzarbeit waren, seien vollständig ausgezahlt worden. «Es erfolgten keine Lohneinbussen», so Thakur. Die Kurzarbeit sei in denjenigen Bereichen eingeführt worden, wo sich pandemiebedingte Arbeitsausfälle ergaben. «Die Aufhebung der Kurzarbeit gilt in unserem Unternehmen bis auf weiteres. Je nachdem, wie sich die Lage in den nächsten Monaten entwickelt, müssen wir uns vorbehalten, wiederum eine Senkung einzelner Pensen in Betracht zu ziehen.»
Sie verweist punkto geplantem Stellenabbau auf eine Medienmitteilung vom Juni. Dort heisst es: «Die NZZ-Mediengruppe plant eine Kostensenkung von knapp 10 Prozent bzw. rund 13 Mio. Franken. Im gesamten Massnahmenpaket enthalten ist auch ein Stellenabbau von unter 5 Prozent, der teilweise durch natürliche Fluktuation abgefedert werden kann. Vereinzelt wird es auch Entlassungen geben.»
Kleinere Verlage mit Schliessungen
Wie sieht es bei kleineren Verlagen aus? Aufgefallen ist zum Beispiel das aufgelöste Wochenblatt «RhoneZeitung». Die Gratiszeitung wurde aus wirtschaftlichen Gründen definitiv eingestellt, nachdem sie zuvor im März vorübergehend sistiert wurde. «Allein mit Werbung lässt sich die RZ nicht mehr finanzieren», wird Matthias Bärenfaller, Leitung Medien Mengis Media, in einem Artikel auf rro.ch zitiert.
Im Medientalk auf SRF 4 sagte Bernhard Rentsch (CR Bieler Tagblatt) zudem, es sei schwierig, als kleine Abozeitung die Balance zu finden zwischen kleinen Umfängen – bedingt durch den Inserateschwund – und den Ansprüchen der Abonnenten gerecht zu werden. Ein Problem, das aber auch Grossverlage wie Tamedia und die NZZ haben. Der Abopreis steigt, der Umfang nimmt ab.