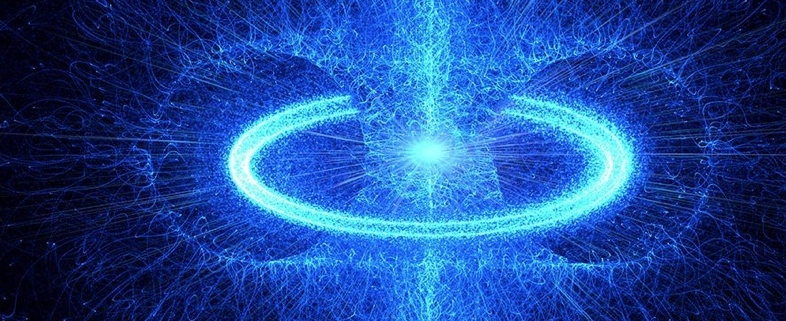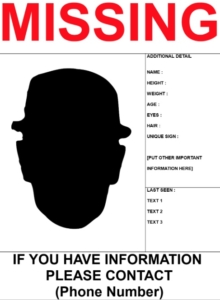Zeitungen von CH-Media verleumden Infosperber
St. Galler, Badener und Zofinger Tagblatt, Solothurner Zeitung, Walliser Bote etc. verbreiten eine Covid-Verschwörungsphantasie.
Von Martina Frei*
Ein identischer ganzseitiger Artikel in den genannten Zeitungen des CH-Media-Konzerns wirft alle in den gleichen Topf, welche die offiziellen Informationen über die Impfstoffe gegen das Corona-Virus hinterfragen. Unter dem Titel «Eine Wahnidee jagt die nächste – warum hört das nicht auf?» nennen diese Zeitungen als neustes Beispiel Berichte einiger Medien über mRNA-Impfstoffe, die mit DNA verunreinigt waren. Dies sei eine «abstruse Behauptung», die «schnell entlarvt» sei, schrieben die Zeitungen.
Autorin Sabine Kuster war lange im Regionalressort tätig und ist keine Wissenschaftsjournalistin. Dass der Pfizer-Impfstoff mit DNA verschmutzt ist, sei «die neueste einer nie endenden Kette von abstrusen Behauptungen von Impfgegnern. […] Über die angebliche Verschmutzung der Impfdosen mit DNA haben wir bisher nicht berichtet. Zu absurd erschien die Behauptung», schrieb sie.
Merke: In diesen CH-Media-Zeitungen werden Informationen nicht aufgenommen, wenn sie «absurd erscheinen». Ob sie zutreffen, wird nicht recherchiert. Dabei wäre das die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten.
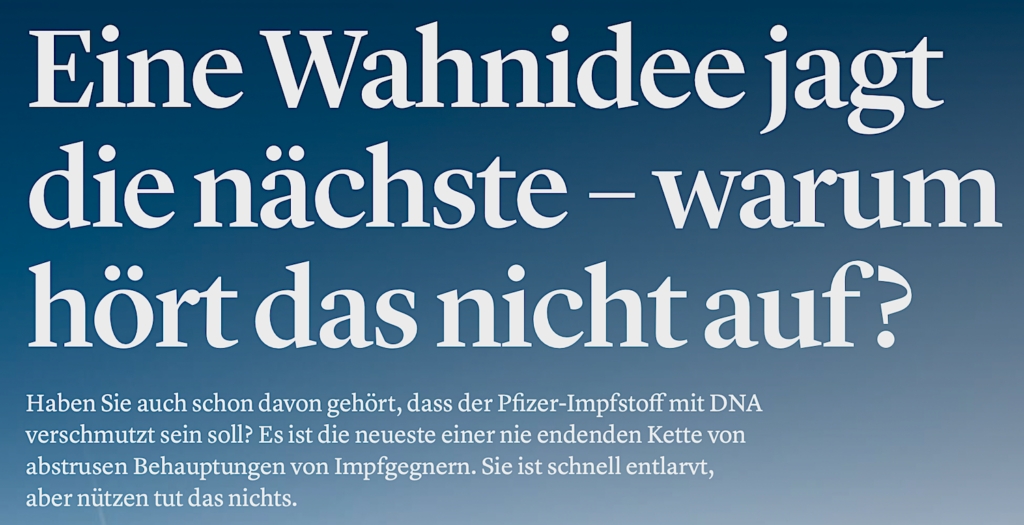
Was CH-Media ausser acht liess …
Der gross aufgemachte Artikel in den Zeitungen von CH-Media zitiert einzig ein deutsches Labor, das DNA im Impfstoff gefunden haben will und stellt dessen Laborleiterin als zweifelhaft dar. Zu Wort kommt die kritisierte Laborleiterin nicht.
Die CH-Media-Zeitungen haben den Eindruck erweckt, nur dieses Labor habe in Impfstoffen Verunreinigungen mit DNA nachgewiesen. Kuster verschweigt unter anderem die DNA-Funde von Phillip Buckhaults.
Buckhaults ist Molekularbiologe, Spezialist für Krebsgene und Professor an der Universität South Carolina. Er hat seine Ausbildung unter anderem an der Johns Hopkins University gemacht und in Wissenschaftszeitschriften wie «PNAS» oder «Nature Communications» Fachartikel veröffentlicht. Von einer solchen Karriere können viele Wissenschaftler nur träumen.
Buckhaults riet allen, die ihm am Herzen liegen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Er ist also weder «Verschwörungstheoretiker» noch «Anti-vaxxer», im Gegenteil. Der bekannte Krebsforscher Wafik El-Deiry bezeichnete Buckhaults als kompetent und integer.
Die Aussagen vor dem Senatsausschuss
Im September 2023 sagte Buckhaults vor einem Senatsausschuss von South Carolina aus. Die Aufzeichnung seiner nicht öffentlichen Aussagen wurde publik. Er habe Milliarden von DNA-Stückchen im Pfizer mRNA-Impfstoff gefunden, berichtete Buckhaults vor dem Ausschuss und sagte: «Ich bin etwas beunruhigt, welche Konsequenzen das für die menschliche Gesundheit und Biologie haben könnte.»
Buckhaults hat seine Untersuchungen nicht veröffentlicht. Er teilte die Resultate dem Senatsausschuss mit, damit Gesetzgeber, Arzneimittelbehörde, Hersteller und Wissenschaftler diese Verunreinigung von Impfstoffen ernst nehmen. Buckhaults schlug vor, möglichst viele fachkundige Wissenschaftler sollten abklären, ob bei Covid-geimpften Menschen im Erbgut von Stammzellen Stücke der fremden DNA aus dem Impfstoff zu finden sind.
Die Grenzwerte für DNA-Verunreinigungen in Impfstoffen seien zu einer Zeit eingeführt wurden, als es um das Spritzen von «nackter» DNA ging, gab Buckhaults zu bedenken. In den mRNA-Impfstoffen sei die DNA aber im Körper transportfähig in Nanopartikel verpackt.
Die CH-Media Journalistin konstatiert «eine läppische Unsorgfältigkeit»
Weil der Journalistin die Information «zu absurd» erschien, erstaunt es nicht, dass die CH-Media-Zeitungen auch nicht darüber informierten, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bereits Ende 2020 und erneut im Frühling 2021 die DNA im Pfizer-Biontech-Impfstoff als Problem erkannte und beanstandete. Das geht aus Dokumenten hervor, die gehackt wurden oder welche die Behörde herausgab.
Möglicherweise betraf dieses Problem nicht alle Produktionsstätten, und vielleicht war es im zweiten Halbjahr 2022 behoben, vielleicht auch nicht. Vieles bleibt im Ungewissen, weil die EMA in den freigegebenen Dokumenten ganze Abschnitte einschwärzte.
Spekulationen oder Befürchtungen könnten Pfizer/Biontech leicht ausräumen, wenn sie offenlegen würden, wie viel DNA sie mit welchen Methoden im Impfstoff gemessen haben.
Die Geheimniskrämerei sollte Medien, die sich als vierte Gewalt im Staat verstehen, hellhörig machen. Doch die Autorin des CH-Media-Artikels nannte die Verunreinigung «eine läppische Unsorgfältigkeit».
Im Patentantrag von Moderna stand etwas anderes
Was sie ebenfalls nicht erwähnte, ist das Patent, das Moderna seit dem Jahr 2018 hält. Darin geht es um Methoden, wie DNA, die bei der Herstellung in das mRNA-Produkt gelangt, entfernt werden kann. Im Patentantrag schrieben Stéphane Bancel, der Mitbesitzer von Moderna, und seine Kollegen: «Die DNA muss entfernt werden, um die Wirksamkeit und die Sicherheit der Therapeutika zu gewährleisten, denn in den Produkten verbleibende DNA könnte die angeborene Immunabwehr aktivieren und hat das Potenzial, bei Patientengruppen krebserregend zu wirken.»
Das deutsche «Paul-Ehrlich-Institut» (PEI), zuständig für die Zulassung und Sicherheit von Impfstoffen in Deutschland, wandte sich in Sachen DNA-Verunreinigung kurz vor Weihnachten 2023 mit einer Mitteilung an medizinische Fachkreise. Aus seiner Sicht hätten die nicht von den Herstellern, sondern von anderen Laboren durchgeführten DNA-Analysen methodische Mängel, schrieb es. Was im Schreiben des PEI nicht steht: Die methodischen Mängel führen laut mehreren Wissenschaftlern dazu, dass der DNA-Gehalt bei den Analysen der Impfstoffe eher unterschätzt wurde.
Bei den DNA-Messungen verliessen sich die Behörden voll auf die Angaben der Hersteller. Eigene Messungen nahmen die Behörden nicht vor.
Anstatt zu recherchieren einfach abgetan
Freilich können Zeitungen wie jene von CH-Media zum Schluss kommen, über die DNA-Verunreinigung nicht zu informieren, weil die Redaktion diese als wenig relevant beurteilt. Doch anderen Medien, die darüber informieren, «Wahnvorstellungen» und das Verbreiten «abstruser Behauptungen» vorzuwerfen, entspringt einer Verschwörungsphantasie. Zu den Verbreitern solcher «Wahnideen» zählt die Autorin auch Infosperber. Mit dieser üblen Nachrede versucht CH-Media, die unabhängige Online-Zeitung Infosperber als unglaubwürdig darzustellen.
Die Arzneimittelbehörde EMA, der Molekularbiologe Philipp Buckhaults und weitere Wissenschaftler (hier ab Minute 13:04 oder hier im «WDR» ab Minute 17:33) hingegen hielten es für nötig, den DNA-Funden in den Impfstoffen nachzugehen.
Eine Replik von Infosperber zum Artikel in den CH-Medien lehnte Chefredaktor Patrik Müller ab: «Wir halten an unserer Darstellung fest.» Er akzeptierte einen «Leserbrief mit maximal 1200 Zeichen».
CH-Media-Zeitungen untergraben ihre eigene Glaubwürdigkeit
upg. Die Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut, das seriöse Zeitungen besitzen. Die beiden erwähnten Artikel in den CH-Media-Zeitungen St. Galler, Badener und Zofinger Tagblatt, Solothurner Zeitung, Walliser Bote u.a untergraben die Glaubwürdigkeit unserer Online-Zeitung Infosperber, indem sie Infosperber mit «Verschwörungstheoretikern», «Wahnideen» und «abstrusen Behauptungen» assoziieren.
Konkret «belegt» wird diese Assoziierung nicht etwa mit konkret bezeichneten Artikeln. Falsche Darstellungen in den Artikeln von Infosperber werden keine genannt.
Seit Ausbruch der Epidemie hat Infosperber zu Corona über 500 Artikel veröffentlicht. Dabei hat Infosperber im Gegensatz zu vielen anderen Medien die Rolle der Vierten Gewalt wahrgenommen und Aussagen und Entscheide von Behörden und Pharmafirmen kritisch hinterfragt.
Infosperber deshalb vorzuwerfen, Verschwörungstheorien oder Wahnideen zu verbreiten, ist eine bösartige Unterstellung.
Die CH-Media-Zeitungen zitieren keinen einzigen Beleg, dass Infosperber eine Verschwörungstheorie oder eine Wahnidee verbreitet hätte.
Das Gegenteil ist der Fall: Infosperber hat über Verschwörungsphantasierer informiert, deren Namen genannt und deren Verschwörungsphantasien als solche aufgezeigt. Auch hat Infosperber über den Nutzen der Impfungen für vulnerable Personen informiert und auf das grosse Ansteckungsrisiko ohne Masken in geschlossenen Räumen mit vielen Personen regelmässig hingewiesen.
Die Redaktion von Infosperber besteht ausschliesslich aus professionellen Journalistinnen und Journalisten. Die meisten Artikel zur Corona-Pandemie haben Urs P. Gasche, seit langem Mitglied des «Schweizer Klubs für Wissenschaftsjournalismus» und Autor mehrerer Bücher über die öffentliche Gesundheit, sowie Martina Frei, ebenfalls Mitglied im «Klub für Wissenschaftsjournalismus», geschrieben. Als praktizierende Ärztin im Nebenberuf hat Martina Frei Menschen gegen Covid-19 geimpft und solche mit Covid behandelt.
*Der Artikel erschien zuerst auf «Infosperber». Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.