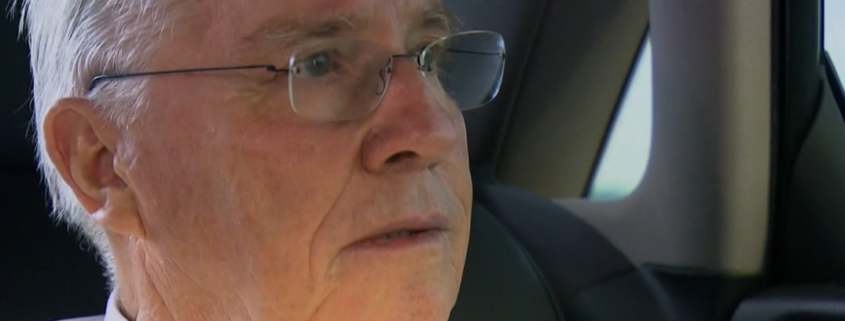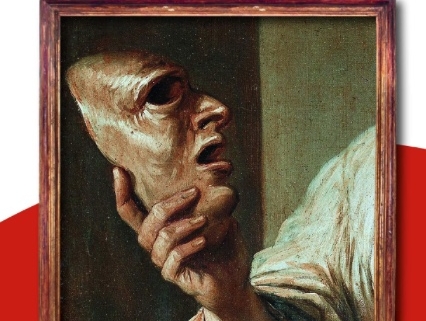Eine Stimme der Vernunft
Ach, wenn es die NZZ nicht gäbe.
Mal Hand aufs Herz: wäre die Welt ärmer, wenn Pietro Supino beschlösse, dass Tx sein Geld auch ohne Newskopieranstalten verdienen sollte? Wenn der Wannerclan seinen Kopfblattsalat entsorgte? Wenn das Ex-Boulevardorgan mit Regenrohr in den Abfluss gurgelte? Gut, ohne «Blick» mitsamt Heads, Chiefs und Leitern wäre die Welt weniger lustig, zugegeben.
Aber passend zum weinerlichen «Offenen Brief» von auf den Schlips getretenen, jammernden Wissenschaftlern (ja, das gilt auch für Nicht-Pimmelträger unter ihnen), veröffentlichte die NZZ ein langes Interview mit dem Islamwissenschaftler Reinhard Schulze. Der war von 1995 bis 2018 Professor für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie in Bern. Er baute dieses Institut auf, das nun entsorgt werden musste.
Schon das Titelzitat lässt an seiner Einschätzung keinen Zweifel: «Dass die Linke so etwas als Wissenschaft darstellt, ist ein Grauen». Zu Fall brachte das Institut nicht zuletzt ein Tweet eines Mitarbeiters, der zum Hamas-Massaker vom 7. Oktober schrieb, das sei das «beste Geschenk, das ich vor meinem Geburtstag bekommen habe». Nicht nur das, er wurde anfänglich von der Institutsleiterin, zufällig seine Gattin, energisch verteidigt.
Wie erklärt Schulze diese Fehlentwicklung? «Abgesehen von der Ungeheuerlichkeit dieses Tweets: Ignoranz und Arroganz, ein völliges Missverständnis der eigenen Rolle als Islamwissenschafter in der Öffentlichkeit. Auch eine infantile Unfähigkeit, sich später für diesen menschenverachtenden Schwachsinn zu entschuldigen.»
Heutzutage, wie die weinerlichen Briefschreiber beweisen, müssen leider wieder Selbstverständlichkeiten gesagt werden:
«Unser Anliegen war es immer, hochgradig zu differenzieren, etwa den innerpalästinensischen Diskurs zu analysieren: Was sind das für politische Positionen, wieso werden sie vertreten, gibt es antisemitische Elemente? Nun wird das Gegenteil gemacht: Es wird entdifferenziert und moralisch geurteilt. Es wird eine palästinensische Persönlichkeit geschaffen, die von einem angeblich homogenen Israel unterdrückt wird. Diese Reduktion, diese Schaffung von Volkskörpern ist ein ursprünglich sehr rechtes politisches Konzept. Dass so etwas von Linken im 21. Jahrhundert als Wissenschaft dargestellt wird, ist ein Grauen.»
Ein Labsal, differenzierte und kluge Ansichten zu hören wie eine Einordnung des Slogans «From the river to the sea»: «Diese Parole ist heute fester Bestandteil eines nationalistischen Diskurses. Dies bedeutet, dass Zugehörigkeit ausschliesslich über Herkunft definiert und die Nation als kollektive Identität in der Geschichte fundamentiert wird. Nicht wenige palästinensische Historiker haben diesen Nationalismus, der Ausschluss, Gewalt und Krieg bedeutet, kritisiert – ähnlich wie israelische Historiker den religiösen Nationalismus in Israel kritisieren. Dass an westlichen Universitäten der palästinensische Nationalismus und damit auch der religiöse Nationalismus der Hamas dermassen unkritisch wahrgenommen, ja gefeiert werden, ist mehr als unverständlich.»
ZACKBUM kann gar nicht genug zitieren: «Ultrareligiosität ist eine völlig neue Form des muslimischen Religionsverständnisses, die sich seit den achtziger Jahren herausgebildet hat. Der Jihadismus ist nur ein Teilaspekt davon. Die Vorstellung, dass der «Islamismus» neben «links» und «rechts» eine dritte Form von Radikalismus und damit eine homogene und eigenständige politische Haltung darstellt, ist falsch. Der religiöse Ultranationalismus der Hamas unterscheidet sich fundamental von der ultrareligiösen Islamdeutung des sogenannten Islamischen Staats oder vom religiösen Ethnonationalismus der Taliban.»
Auf seine Weise zieht Schulze ein Fazit, wohin sich der «wissenschaftliche Diskurs» inzwischen bewegt hat. Nämlich nach unten, ins Seichte, in Echokammern, in Ausschliesslichkeiten, Setzungen, in den völligen Verzicht, zwischen Mensch, Meinung und angeblicher Haltung zu differenzieren:
«Mir hat nie jemand vorgehalten, ich dürfe als alter weisser Mann aus Deutschland nicht über den Islam reden. Das wäre nun sicher anders.»
Oder anders gesagt: einem solchen alten weissen Mann aus Deutschland zu lauschen, das ist unvergleichlich viel interessanter als dem Gejammer und Gegreine von inzwischen über 1000 Unterzeichnern eines «Offenen Briefs», der das Elend der aktuellen Geisteswissenschaften erbärmlich auf den Punkt bringt.