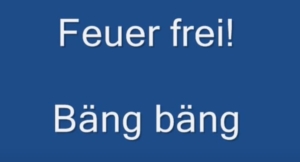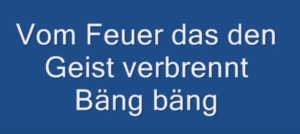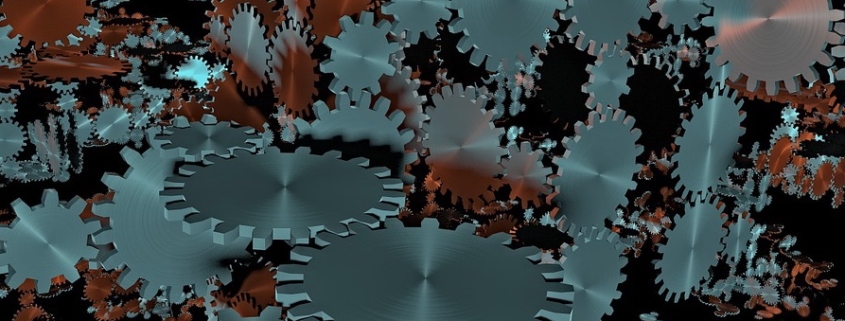Lustige Zeiten bei der NZZ
Wenn die NZZ dem Schwesterblatt NZZaS eine reinwürgt.
Früher war es legendär, wie sich «SonntagsBlick» und «Blick» gegenseitig gehasst haben. Weiterzug einer Story, gemeinsame Kampfbündnisse? I wo, wenn man sich gegenseitig ignorieren oder in den Unterleib treten konnte: sehr gerne.
Das hat sich im Rahmen der Sparmassnahmen und der Skelettierung der beiden Blätter erledigt. Aber im Hause NZZ gibt’s noch Potenzial.
Die NZZaS wartete mit dem Primeur auf, dass sie einen der beiden Hauptbeschuldigten in der Affäre Vincenz kurz vor Prozessbeginn zu einem längeren Interview überreden konnte. Nachdem Beat Stocker eisern die ganzen, quälenden Jahre der Untersuchung geschwiegen hatte.
Immerhin, was man auch vom Inhalt seiner Aussagen halten mag. Da könnte man ja von der NZZ etwas Applaus erwarten.
Könnte man, gibt’s aber nicht. Im Gegenteil. Am Dienstag nach dem Interview meldet sich Lorenz Honegger in der NZZ zu Wort. Die zweite Generation Honegger zieht blank:

Das war wohl nix, daher ist sein vernichtendes Urteil natürlich gepaart mit der unausgesprochenen Frage, wieso sich die NZZaS dafür hergegeben habe.
Nun baut Honegger seine Anklage auf die Aussagen von «zwei führenden Schweizer Litigation-PR-Experten». Darunter versteht man die Benützung der Öffentlichkeit zwecks möglicher Beeinflussung von Richtern.
Der eine Experte ist «Patrick Krauskopf, Professor für Wirtschaftsrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.» Das Problem: der ist völlig unbeleckt von Kenntnissen über das Strafrecht und auch sonst in der Branche niemandem als Litigation-PR-Experte bekannt.
Aber praktisch, dass er das interview kritisch sieht: «Ich würde den Angeklagten die Botschaft nicht selbst überbringen lassen.» Und: ««Qui s’excuse, s’accuse», sagt Krauskopf.»
Der zweite «führende Experte» heisst «Laurent Ashenden, Gründer und Geschäftsführer der PR-Agentur Voxia». Der ist ebenfalls noch nie öffentlich in dieser Funktion aufgefallen, was wohl auch den eher dürftigen Trackrecord auf seiner Webseite erklärt. Aber auch Ashenden darf zuschlagen:
«Seine Message ist: Ich bin unschuldig. Aber er schafft es nicht, zu überzeugen.»
Krauskopf darf dann noch das letzte Wort behalten: «Man wird sich fragen, ob es geschickt war, am zweiten Neujahrstag mit einem solchen Interview herauszukommen.»
Anlass, Honegger ein paar Fragen zu stellen:
-
Halten Sie es für seriös, mit diesen beiden No-Names Kritik am Interview im Schwesterblatt zu üben?
-
Aufgrund welcher Kriterien haben Sie die beiden ausgewählt?
-
Sucht man nach den Begriffen «Litigation, Experte, Schweiz» kommt eine ganze Reihe von solchen Angeboten seriöser Kanzleien. Wieso haben Sie keine der so auffindbaren gewählt?
Trotz grosszügig bemessener Antwortfrist verfiel Honegger aber in finsteres Schweigen, was angesichts des sonstigen Niveaus der NZZ doch überrascht.
Da bleibt Platz für Interpretationen. Wie wär’s damit: die grösste Veränderung in den letzten Monaten war der Antritt des neuen NZZaS-Chefredaktors Jonas Projer. Der versucht, dem Sonntagsblatt etwas mehr Drive zu geben und vor allem die Interaktion mit der Leserschaft zu verstärken.
Projer hat dabei die Hypothek, dass er als TV-Mann abgestempelt ist und zudem von «Blick»-TV kommt. Da schüttelt es jeden alten NZZler durch, der das eigene «Format» als Benchmark für seriöse TV-Mache sieht.
Zudem ist es nicht ganz klar, wie eigentlich die Hierarchie zwischen God Almighty Eric Gujer und Projer aussieht. Bei seinen beiden Vorgängern war klar, wer Herr ist und wer Knecht. Durch die weitgehende Zusammenlegung von NZZ und NZZaS schrumpft ja auch das Königreich des NZZaS-Chefs.
Da ein unbedeutender Redaktor wie Honegger so ein Stück sicherlich nicht ohne Einverständnis aller oberen Chargen veröffentlichen konnte, stellt sich die lustige Frage, ob das ein öffentlicher Warnschuss von der Kommandobrücke des Dampfers NZZ vor den Bug des Beiboots NZZaS war.
Gujer könnte sich die naheliegende Frage stellen, wozu es eigentlich noch einen eigenständigen zweiten Chef im Hause braucht …